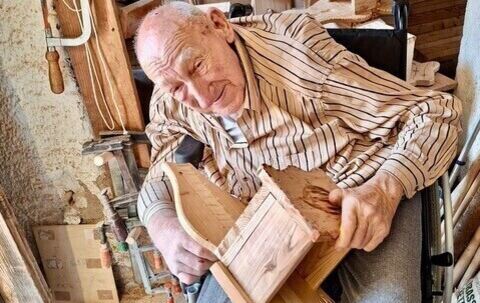Und weiter: Ohne ein kommunales Starkregenrisikomanagement mit dem Erstellen von Starkregengefahrenkarten, der Durchführung einer Risikoanalyse und dem Aufstellen eines kommunalen Handlungskonzepts wird es künftig wohl immer schwieriger, sich hinlänglich vor Starkregenereignissen zu schützen. Alle müssen mitmachen, Bürger und Gemeinden. Die Infoveranstaltung hatten die drei Bürgermeister der Gemeinden Waging am See, Taching am See und Wonneberg organisiert.
»Der ganzheitliche Überflutungsschutz besteht aus dem Entwässerungssystem mit Regenwassermanagement, den Verkehrs- und Freiflächen und dem Objektschutz. Hierfür müssen Grundstückseigentümer, kommunale und staatliche Behörden und Ämter zusammenarbeiten«, sagte Professor Dr. Frank Wolfgang Günthert. Er hat zu Sturzfluten am Institut für Wasserwesen der Universität der Bundeswehr in München geforscht und kritisiert, dass sich erst rund 100 Gemeinden in Bayern um ein angemessenes Risikomanagement kümmern. Dabei machten detaillierte Gefahrenkarten, die der Freistaat fördere, angemessene Schutzmaßnahmen möglich. »Sie erfassen Wasserläufe, Höhen und Senken der Landschaft, aber auch bauliche Engstellen in Ortschaften und sie legen die Risikogebiete bei einer Flutwelle fest. Die Gemeinden handeln beim Erstellen der Gefahrenkarten im Interesse der Grundstückseigentümer, so dass jeder weiß, ob und wie er gefährdet ist.«
Keine Handlungspflicht für Gemeinden
Georg Wendlinger von der Kommunalaufsicht beschrieb die kommunale Aufgabenstruktur und informierte unter anderem über gemeindliche Pflichtaufgaben, zu denen aber nicht der Schutz vor Starkregen und damit einhergehenden Überschwemmungen zählten. Wendlinger erklärte, dass die Gemeinden sich um viele Aspekte rund um Überschwemmungen und Starkregen kümmern. »Sie haben hier allerdings keine Handlungspflicht.« Zum kommunalen Aufgabenbereich in der Vorsorge gehöre der Unterhalt der kleinen Gewässer, die Abwasserentsorgung, das Tätigwerden als örtliche Sicherheitsbehörde mit dem Bereithalten einer einsatzfähigen Feuerwehr und die Bauleitplanungen, in der Hochwasserschutz mitberücksichtigt werde. Laut Wendlinger besteht in den Gemeinden keine Entsorgungspflicht für die großen Mengen an Regenwasser aus Starkregenereignissen, die auf freier Flur entstehen. »Sie müssen sich auch nicht darum kümmern, sämtliche angrenzenden bebauten Bereiche vor jeglichem Wasserzufluss zu schützen.« Die Schutzvorkehrungen, die die Gemeinden treffen, ersparen es den Eigentümern von Grundstücken also nicht, eigene Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
Der Geschäftsführer des Siegsdorfer Ingenieurbüros Aquasoli, Bernhard Unterreitmeier, konkretisierte die baulichen Maßnahmen an Gebäuden. Es sei ratsam, bodengleiche Eingänge zu vermeiden, Lichtschächte wasserdicht aufzukanten, Schwellen vor Türen und Überfahrschwellen an Tiefgaragen anzubringen, bodennahe Außenwände abzudichten, Dichtungen an Leitungsdurchführungen anzubringen und für eine Rückstausicherung zu sorgen. Unterreitmeier hat in einer Starkregenstudie auch die Auswirkungen von Starkregen auf einzelne Ortsteile der Gemeinde Taching untersucht. Er legte den Zuhörern ans Herz, sich die Starkregen-Warn-App des Deutschen Wetterdienstes herunterzuladen. Die App biete eine Übersicht über die aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf die Gemeindeebene.
4721 Hilfskräftein der Feuerwehr
Die extremen Wetterphänomene sind auch für die Feuerwehren eine Herausforderung geworden. Sie sind die ersten, die gerufen werden. »Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr – und wenn die Welt untergeht, dann auch«, machte Kreisbrandrat Christof Grundner deutlich. Er erklärte auch, was Behörden im Katastrophenfall dürfen, wie sie dabei zum Schutz der Bevölkerung vorgehen und welche Ausrüstungen und Ausbildungen notwendig sind. Wichtig sei, dass genügend Feuerwehrleute zur Verfügung stünden. Mit den aktuell 76 Freiwilligen Feuerwehren und den je zwei Werksfeuerwehren und Betriebsfeuerwehren sei der Landkreis Traunstein gut aufgestellt. »Es gibt derzeit 4721 Hilfskräfte in der Feuerwehr.«
Andreas Hahn vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft informierte über den finanziellen Schutz vor Naturgefahren und über die Versicherungsmöglichkeiten. Hahn stellte heraus, dass eine standardmäßige Gebäudeversicherung, die auch in Deutschland auftretenden Elementargefahren nicht abdecke. Gegen Überschwemmungen, Starkregen, Rückstau, Schneedruck, Lawinen, Erdbeben oder Erdrutsche müsse man sich zusätzlich versichern. Wichtig sei, mit Blick auf zunehmende Extremwettereignisse mehr Gebäude gegen Elementarschäden zu versichern. Die Versicherungswirtschaft lehne aber eine Pflichtversicherung für Elementarschäden ab, weil diese keinen einzigen Schaden verhindere, negative Einflüsse auf die Prävention habe und alle Folgen von Naturkatastrophen bei den Versicherten abgeladen würden.
»Die Versickerung geschieht hauptsächlich entlang von Regenwurmgängen und Wurzeln«, erklärte Georg Hermannsdorfer, der sich am Amt für Ländliche Entwicklung für die Projekte von »boden:ständig« engagiert. Er empfahl, mehr Bäume und Sträucher im eigenen Garten zu pflanzen, anstatt auf Zierrasen auf Naturrasen zu setzen und möglichst wenig Fläche auf einem Grundstück zu versiegeln. Den Landwirten legte Georg Hermannsdorfer ans Herz, entlang der kleinen Bäche Ufergehölze zu setzen, die sowohl das Ufer als auch die Bachsohle schützen und den Abfluss verzögern. »Rechts und links vom Bach ein zehn Meter breiter Gehölzstreifen wäre ideal.« Aus diesen nachwachsenden Rohstoffen ließen sich später Hackschnitzel zum Heizen gewinnen, so Hermannsdorfer.
ca