Kleiderraub nach dem dritten Fall
Seit dem Mittelalter betet die katholische Kirche den Kreuzweg

Kalvarienberg (Christus zwischen den zwei Schächern) vor der Wallfahrtskirche Fißlkling (b. Kraiburg/Inn).
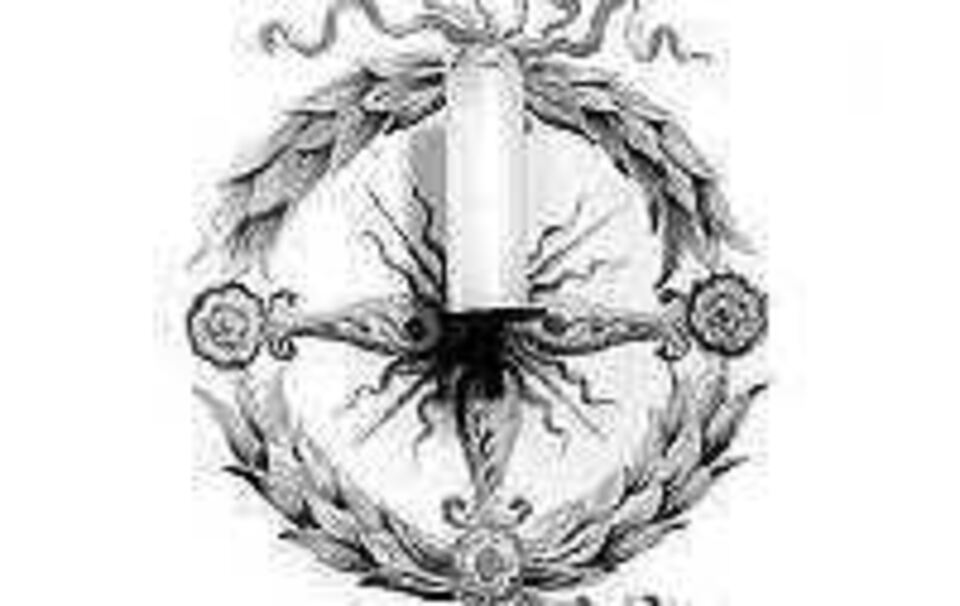
Apostelkreuz mit Kerze, Wandfresko (Tann b. Aschau/Inn)
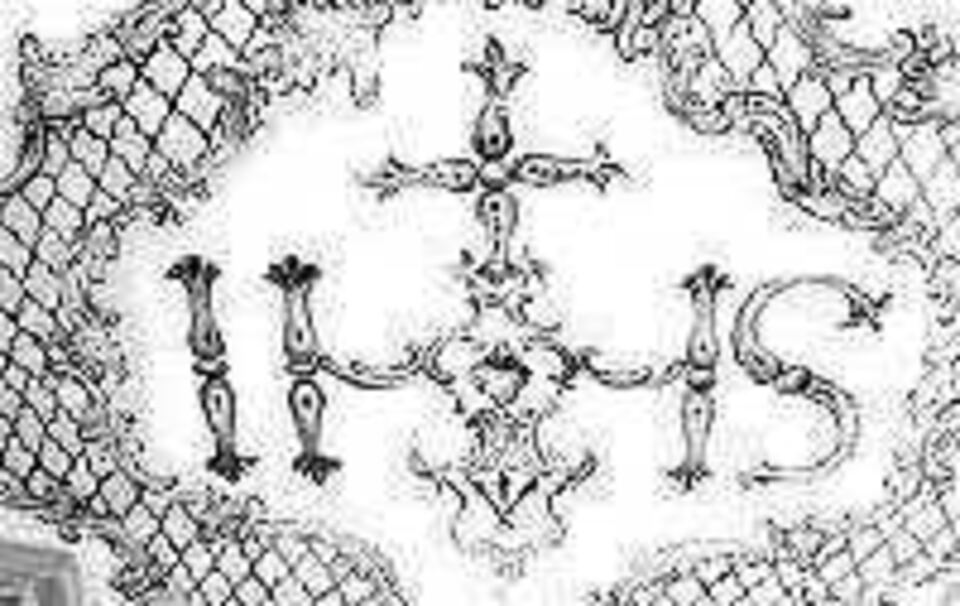
IHS-Zeichen mit Passionssymbolen, Deckenfresko (Tann b. Aschau/Inn)
Die Franziskaner haben sie besonders gepflegt und im 14./15. Jahrhundert eingeführt: die Kreuzwegandachten. Wer eine katholische Kirche betritt, kann den Kreuzweg Jesu Christi an den Wänden entlang gehen. Hier hängt eine Serie von (zumeist) vierzehn Bildern, die die Stationen des leidenden Gottessohns veranschaulichen. Oft mit einer Realistik, die den Blick von manchem Stationsbild rasch wieder abwenden lässt – zu grausam wird demonstriert und zu Bewusstsein gebracht, wie Jesus auf seinem letzten Gang auf den Kalvarienberg seinen Tod Schritt für Schritt voraus erlebt. Kein jäher Tod, der den Schmerzensmann ereilt, sondern ein allmähliches Dahinscheiden, ein Martyrium der Langsamkeit.
Die Volksfrömmigkeit scheut seit jeher vor Drastik nicht zurück. Sie liebt das blutstropfende, brennende Herz Mariä und Jesu. Sie zeigt die Steinigung des heiligen Stephanus lebensnah. Die Pfeile im Leib des sterbenden heiligen Sebastian entfernt sie nicht. Sankt Laurentius wird ohne Rücksicht auf zarte Gemüter auf dem Rost gebraten, wobei die Knechte des heidnischen Auftraggebers den geschundenen nackten Körper mit ihren Lanzenspitzen durchbohren. Oft deuten nur noch Attribute auf ein grausames Lebensende einer für Christus Gestorbenen – Katharinas zerbrochenes Rad und blutbeflecktes Schwert.
Der Kreuzweg Christi wird in der Regel in 14, seltener in 16 Stationen bildlich, betrachtend und betend vor Augen und zu Gemüte geführt, von der Burg Antonia bis Golgota oder weiter bis zur Auffindung des heiligen Kreuzes durch die heilige Helena, die Mutter Kaiser Konstantins. Das »peu a peu« fortschreitende, dramatische Geschehen lässt die Gläubigen die Passion des Jesus von Nazareth wie im Theater mitvollziehen. Vorlage sind die Texte des Neuen Testaments. Intention: das fromme Gedenken der Passion als Reflexion des eigenen Leidenswegs auf Erden, aber auch des konkreten historischen Geschehens nahe Jerusalem. Beim Nachvollzug des Kreuzwegs Christi soll dem Gläubigen die ganze Härte und Pein der Demütigungen, Folterungen und unschuldigen Tötung des »Rex Judaeorum« klar werden, wobei die Selbstbezichtigung des den Erlöser zu Tode quälenden Menschen kohärent werden soll: Ich selbst, der hier mit Christus den Kreuzweg geht, bin mitschuldig an seinem schrecklichen Ende.
Die Frömmigkeitsgeschichte insbesondere des Barock und der Gegenreformation kennt neben der im Gotteshaus unter Anleitung des betenden und betrachtenden Priesters vollzogenen Kreuzweg-Andacht auch Formen der persönlichen Passions-Meditation. Am meisten verbreitet waren die Kreuzwegandachten als Anhang der Andachtsbücher. So hatte der Christ Gelegenheit – ähnlich den an den Kirchenwänden entlang aufgehängten Bild-Tafeln – den Kreuzweg jederzeit zu beten, unabhängig von der »Hoch-Zeit« dieser Andachtsform, der Fasten- oder Passionszeit. Begleitet waren diese gedruckten Kreuzweg-Andachten von ausdrucksstarken Kupferstichen oder Lithographien. Ausschließlich aus solchen bestanden so genannte Ziehharmonika-Kreuzwege. Sie waren zum Auseinanderfalten und zum Aufstellen, wo immer man wollte, den Reiseklappaltärchen ähnlich. Handliche dünne Kreuzweg-Heftchen, die sich auf die einzelnen Kreuzweg-Stationen konzentrierten, wurden besonders an den Gnadenorten, aber auch im allgemeinen Devotionalien- und religiösen Buchhandel angeboten. Das 19. Jahrhundert bietet diese bebilderten Heftchen noch um ein paar Pfennige an, viel versprechend: Sie waren meistens mit Ablässen verbunden. So etwa das beim Verlag der J. Lutzenberger’schen Buchhandlung in Altötting um 1850 erschienene, besonders in Bayern weit verbreitete, der ganzen christlichen Familie empfohlene Heftchen für die XIV Kreuzwegstationen mit dem ausführlichen Titel:
Heilige Wallfahrt, oder Besuchung des heiligen Kreuz - Weges, welchen unser Herr und Heiland Jesus Christus mit dem schweren Kreuze beladen, vom Richthause des Pilatus bis auf den Calvarienberg gegangen ist.
Die Andachtsschrift, ohne weiteres bei Ortsveränderung mitzunehmen, beginnt mit einem »Unterricht«, also mit einer Art Didaktik der Kreuzweg-Andacht. Maria, die Mutter Gottes, habe – wie vielen Heiligen nach ihr – »jene Orte, wo Christus gelitten, besonders den Kreuzweg, den er gegangen, mit höchster Andacht sehr oft besucht«. Christen in Jerusalem folgten diesem Beispiel noch heute. Päpste hätten ihnen wie auch den nicht nach Jerusalem Gereisten Ablässe verliehen: Innozenz XI. am 5. September 1686 habe den Patres Francisci »gnädig erlaubt«, in ihren Kirchen den Ablass-Kreuzweg einzuführen. Clemens XII. habe am 16. Januar 1731 verfügt, »es können diese Ablässe bei jedem Kreuzwege gewonnen werden, der wo immer mit Gutheißung und Zustimmung des Diözesan-Bischofes oder des Vorstehers der Kirche, des Klosters, Spitales und Ortes durch einen Franziskaner oder einen anderen vom Papste eigens hiezu bevollmächtigten Priester errichtet wird«. Nicht lebenden Menschen, wohl aber den Armen Seelen im Fegfeuer kämen diese Ablässe zugute.
Ablass-Gewinn war eine der beiden Bedingungen: Bei jedem Bild soll das Leiden des Herrn meditiert werden. Man solle möglichst zu jeder Station hingehen oder sich ihr wenigstens zuwenden, um das dargestellte Geheimnis »auswendig oder auf die im Kreuzwegbüchlein angegebene Weise« zu betrachten.
Die 14 Stations-Szenen in Form kleiner Andachtsbilder entbehren jeglicher künstlerischer Hand. Es handelt sich um qualitativ mindere Drucke von Kupferstichen vom Format 5,5 mal 8 Zentimeter. Sie kommen durchgehend auf der linken Seite zwischen der Ablass-Angabe (z. B. »7 Jahre und 7 Quadrag.«, d. h. Quadragene, also 40 Tage) und der Nennung der einzelnen Stationen zu stehen:
I. Station: Jesus wird zum Tode des Kreuzes verurtheilt.
II. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter.
III. Station: Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuze.
IV. Station: Jesus begegnet seiner betrübtesten Mutter.
V. Station: Simon von Cyrene trägt Jesus das Kreuz nach.
VI. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.
VII. Station: Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuze.
VIII. Station: Jesus redet zu den weinenden Töchtern von Jerusalem.
IX. Station: Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuze.
X. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt.
XI. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt.
XII. Station: Jesus wird erhöht und stirbt am Kreuze.
XIII. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoos Mariä gelegt.
XIV. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.
Der unbekannte Verfasser dieser religiösen Schrift stellte an den Anfang jeder Stations-Meditation die noch heute gebräuchliche Formel:
Ich bete Dich an, Herr Jesus Christus! Und lobpreise Dich; denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
Nach einer knappen Seite mit einer »Betrachtung« folgt ein fast ebenso langes, aber entschieden größer und zudem fett gedrucktes »Gebet«, das mit der Empfehlung, ein »Vater unser« und »Ave Maria« nicht zu vergessen und an den Schluss den Stoßseufzer:
Gekreuzigter Herr Jesus Christus! Erbarme Dich meiner!
zu setzen. Hier wird deutlich, dass es sich nicht um eine kommunikative, sondern um eine private Frömmigkeitsübung handelt, der sich der Gläubige freiwillig unterzieht. Ihm soll in Fleisch und Blut übergehen, welch bitteren Leidensweg Jesus ging, dass er, von Pilatus verurteilt und mit dem Kreuz beladen, nach dreimaligem Fall und mehreren Begegnungen (Mutter, weinende Frauen, Veronika, Simon von Cyrene) zunächst seiner Kleider beraubt, dann ans Kreuz geheftet und daran erhöht wurde und starb, dass den Leichnam, vom Kreuz abgenommen, Maria in ihrem Schoß hielt, bevor er ins Grab gelegt wurde.
Jesus Leichnam wird in fremder Grabstätte begraben. Er, der nichts im Leben besaß, wo Er sein heiligstes Haupt hinlegte, fand auch kein eigenes Grab auf der Welt, weil Er nämlich von dieser Welt nicht war. Du, der du so sehr von ihr abhängst, bist du nicht von dieser Welt? Verachte die Welt, damit du mit ihr nicht zu Grunde gehst!
Wie die »Betrachtung« zur letzten Station zeigt, enthält sie jeweils einen kurzen historischen Bezug, dem aber die Ermahnung zur Hinwendung an das Jenseits folgt (hier die Weltverachtung), um nicht in der (bösen, Gott abgewandten) Welt zu scheitern. Moderne Kreuzwegandachten verlassen diese appellierenden und moralisierenden Empfehlungen zur Lebensführung im Geiste des Kreuzwegs Jesu Christi. Sie greifen die Traditionen mit Gebetsformel-Wiederholung und Wechsel von Betrachtung und Gebet auf, ergänzen sie (in der Anleitung Liborius Olaf Lumma, »Unser Lebensatem, der Gesalbte des Herrn«, Bonifatius Verlag 2005) aber sinnvoll durch Lesung (zur 14. Station z. B. aus dem Buch des Propheten Jesaja, Jes 53, 8 – 10 a oder dem Lukasevangelium, Lk 23, 50 – 53), Stille, Fürbitten, Oration, Lobpreis und sogar Gesang (»Er wird der Erde übergeben« oder »Christus, Gotteslamm«). Die seit alters her abgegriffenen Kreuzweg- »Ikonen« werden durch zeitgemäße Kunstwerke ersetzt, bei Lumma durch Bronzen des Künstlers Gereon Heil für die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Siegen. Sie betonen stark den Zeichencharakter der Kreuzweg-Stadien: »So bleibt«, so heißt es zum »Abschluss«-Bild eines korpuslosen Kreuzes in offenem Rahmen mit einem Stein oder Eisenklumpen an der rechten unteren Ecke, »am Ende all unseres Nachdenkens, Schaffens und Betens ein schlichtes Symbol. So schlicht, dass es fast keine Bedeutung zu haben scheint. Und doch so klar, dass es all unser Bemühen übersteigt und zum Signal des mitleidenden, des heilenden, des rettenden Gottes wird, der den Tod für immer besiegt: das Kreuz«.
Hans Gärtner
11/2006
Die Volksfrömmigkeit scheut seit jeher vor Drastik nicht zurück. Sie liebt das blutstropfende, brennende Herz Mariä und Jesu. Sie zeigt die Steinigung des heiligen Stephanus lebensnah. Die Pfeile im Leib des sterbenden heiligen Sebastian entfernt sie nicht. Sankt Laurentius wird ohne Rücksicht auf zarte Gemüter auf dem Rost gebraten, wobei die Knechte des heidnischen Auftraggebers den geschundenen nackten Körper mit ihren Lanzenspitzen durchbohren. Oft deuten nur noch Attribute auf ein grausames Lebensende einer für Christus Gestorbenen – Katharinas zerbrochenes Rad und blutbeflecktes Schwert.
Der Kreuzweg Christi wird in der Regel in 14, seltener in 16 Stationen bildlich, betrachtend und betend vor Augen und zu Gemüte geführt, von der Burg Antonia bis Golgota oder weiter bis zur Auffindung des heiligen Kreuzes durch die heilige Helena, die Mutter Kaiser Konstantins. Das »peu a peu« fortschreitende, dramatische Geschehen lässt die Gläubigen die Passion des Jesus von Nazareth wie im Theater mitvollziehen. Vorlage sind die Texte des Neuen Testaments. Intention: das fromme Gedenken der Passion als Reflexion des eigenen Leidenswegs auf Erden, aber auch des konkreten historischen Geschehens nahe Jerusalem. Beim Nachvollzug des Kreuzwegs Christi soll dem Gläubigen die ganze Härte und Pein der Demütigungen, Folterungen und unschuldigen Tötung des »Rex Judaeorum« klar werden, wobei die Selbstbezichtigung des den Erlöser zu Tode quälenden Menschen kohärent werden soll: Ich selbst, der hier mit Christus den Kreuzweg geht, bin mitschuldig an seinem schrecklichen Ende.
Die Frömmigkeitsgeschichte insbesondere des Barock und der Gegenreformation kennt neben der im Gotteshaus unter Anleitung des betenden und betrachtenden Priesters vollzogenen Kreuzweg-Andacht auch Formen der persönlichen Passions-Meditation. Am meisten verbreitet waren die Kreuzwegandachten als Anhang der Andachtsbücher. So hatte der Christ Gelegenheit – ähnlich den an den Kirchenwänden entlang aufgehängten Bild-Tafeln – den Kreuzweg jederzeit zu beten, unabhängig von der »Hoch-Zeit« dieser Andachtsform, der Fasten- oder Passionszeit. Begleitet waren diese gedruckten Kreuzweg-Andachten von ausdrucksstarken Kupferstichen oder Lithographien. Ausschließlich aus solchen bestanden so genannte Ziehharmonika-Kreuzwege. Sie waren zum Auseinanderfalten und zum Aufstellen, wo immer man wollte, den Reiseklappaltärchen ähnlich. Handliche dünne Kreuzweg-Heftchen, die sich auf die einzelnen Kreuzweg-Stationen konzentrierten, wurden besonders an den Gnadenorten, aber auch im allgemeinen Devotionalien- und religiösen Buchhandel angeboten. Das 19. Jahrhundert bietet diese bebilderten Heftchen noch um ein paar Pfennige an, viel versprechend: Sie waren meistens mit Ablässen verbunden. So etwa das beim Verlag der J. Lutzenberger’schen Buchhandlung in Altötting um 1850 erschienene, besonders in Bayern weit verbreitete, der ganzen christlichen Familie empfohlene Heftchen für die XIV Kreuzwegstationen mit dem ausführlichen Titel:
Heilige Wallfahrt, oder Besuchung des heiligen Kreuz - Weges, welchen unser Herr und Heiland Jesus Christus mit dem schweren Kreuze beladen, vom Richthause des Pilatus bis auf den Calvarienberg gegangen ist.
Die Andachtsschrift, ohne weiteres bei Ortsveränderung mitzunehmen, beginnt mit einem »Unterricht«, also mit einer Art Didaktik der Kreuzweg-Andacht. Maria, die Mutter Gottes, habe – wie vielen Heiligen nach ihr – »jene Orte, wo Christus gelitten, besonders den Kreuzweg, den er gegangen, mit höchster Andacht sehr oft besucht«. Christen in Jerusalem folgten diesem Beispiel noch heute. Päpste hätten ihnen wie auch den nicht nach Jerusalem Gereisten Ablässe verliehen: Innozenz XI. am 5. September 1686 habe den Patres Francisci »gnädig erlaubt«, in ihren Kirchen den Ablass-Kreuzweg einzuführen. Clemens XII. habe am 16. Januar 1731 verfügt, »es können diese Ablässe bei jedem Kreuzwege gewonnen werden, der wo immer mit Gutheißung und Zustimmung des Diözesan-Bischofes oder des Vorstehers der Kirche, des Klosters, Spitales und Ortes durch einen Franziskaner oder einen anderen vom Papste eigens hiezu bevollmächtigten Priester errichtet wird«. Nicht lebenden Menschen, wohl aber den Armen Seelen im Fegfeuer kämen diese Ablässe zugute.
Ablass-Gewinn war eine der beiden Bedingungen: Bei jedem Bild soll das Leiden des Herrn meditiert werden. Man solle möglichst zu jeder Station hingehen oder sich ihr wenigstens zuwenden, um das dargestellte Geheimnis »auswendig oder auf die im Kreuzwegbüchlein angegebene Weise« zu betrachten.
Die 14 Stations-Szenen in Form kleiner Andachtsbilder entbehren jeglicher künstlerischer Hand. Es handelt sich um qualitativ mindere Drucke von Kupferstichen vom Format 5,5 mal 8 Zentimeter. Sie kommen durchgehend auf der linken Seite zwischen der Ablass-Angabe (z. B. »7 Jahre und 7 Quadrag.«, d. h. Quadragene, also 40 Tage) und der Nennung der einzelnen Stationen zu stehen:
I. Station: Jesus wird zum Tode des Kreuzes verurtheilt.
II. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter.
III. Station: Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuze.
IV. Station: Jesus begegnet seiner betrübtesten Mutter.
V. Station: Simon von Cyrene trägt Jesus das Kreuz nach.
VI. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.
VII. Station: Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuze.
VIII. Station: Jesus redet zu den weinenden Töchtern von Jerusalem.
IX. Station: Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuze.
X. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt.
XI. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt.
XII. Station: Jesus wird erhöht und stirbt am Kreuze.
XIII. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoos Mariä gelegt.
XIV. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.
Der unbekannte Verfasser dieser religiösen Schrift stellte an den Anfang jeder Stations-Meditation die noch heute gebräuchliche Formel:
Ich bete Dich an, Herr Jesus Christus! Und lobpreise Dich; denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
Nach einer knappen Seite mit einer »Betrachtung« folgt ein fast ebenso langes, aber entschieden größer und zudem fett gedrucktes »Gebet«, das mit der Empfehlung, ein »Vater unser« und »Ave Maria« nicht zu vergessen und an den Schluss den Stoßseufzer:
Gekreuzigter Herr Jesus Christus! Erbarme Dich meiner!
zu setzen. Hier wird deutlich, dass es sich nicht um eine kommunikative, sondern um eine private Frömmigkeitsübung handelt, der sich der Gläubige freiwillig unterzieht. Ihm soll in Fleisch und Blut übergehen, welch bitteren Leidensweg Jesus ging, dass er, von Pilatus verurteilt und mit dem Kreuz beladen, nach dreimaligem Fall und mehreren Begegnungen (Mutter, weinende Frauen, Veronika, Simon von Cyrene) zunächst seiner Kleider beraubt, dann ans Kreuz geheftet und daran erhöht wurde und starb, dass den Leichnam, vom Kreuz abgenommen, Maria in ihrem Schoß hielt, bevor er ins Grab gelegt wurde.
Jesus Leichnam wird in fremder Grabstätte begraben. Er, der nichts im Leben besaß, wo Er sein heiligstes Haupt hinlegte, fand auch kein eigenes Grab auf der Welt, weil Er nämlich von dieser Welt nicht war. Du, der du so sehr von ihr abhängst, bist du nicht von dieser Welt? Verachte die Welt, damit du mit ihr nicht zu Grunde gehst!
Wie die »Betrachtung« zur letzten Station zeigt, enthält sie jeweils einen kurzen historischen Bezug, dem aber die Ermahnung zur Hinwendung an das Jenseits folgt (hier die Weltverachtung), um nicht in der (bösen, Gott abgewandten) Welt zu scheitern. Moderne Kreuzwegandachten verlassen diese appellierenden und moralisierenden Empfehlungen zur Lebensführung im Geiste des Kreuzwegs Jesu Christi. Sie greifen die Traditionen mit Gebetsformel-Wiederholung und Wechsel von Betrachtung und Gebet auf, ergänzen sie (in der Anleitung Liborius Olaf Lumma, »Unser Lebensatem, der Gesalbte des Herrn«, Bonifatius Verlag 2005) aber sinnvoll durch Lesung (zur 14. Station z. B. aus dem Buch des Propheten Jesaja, Jes 53, 8 – 10 a oder dem Lukasevangelium, Lk 23, 50 – 53), Stille, Fürbitten, Oration, Lobpreis und sogar Gesang (»Er wird der Erde übergeben« oder »Christus, Gotteslamm«). Die seit alters her abgegriffenen Kreuzweg- »Ikonen« werden durch zeitgemäße Kunstwerke ersetzt, bei Lumma durch Bronzen des Künstlers Gereon Heil für die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Siegen. Sie betonen stark den Zeichencharakter der Kreuzweg-Stadien: »So bleibt«, so heißt es zum »Abschluss«-Bild eines korpuslosen Kreuzes in offenem Rahmen mit einem Stein oder Eisenklumpen an der rechten unteren Ecke, »am Ende all unseres Nachdenkens, Schaffens und Betens ein schlichtes Symbol. So schlicht, dass es fast keine Bedeutung zu haben scheint. Und doch so klar, dass es all unser Bemühen übersteigt und zum Signal des mitleidenden, des heilenden, des rettenden Gottes wird, der den Tod für immer besiegt: das Kreuz«.
Hans Gärtner
11/2006



