München »der furchtbarste, der ödeste Ort«
US-Autor Mark Twain verbrachte den Winter 1878/79 wegen Schreibblockade in Bayern


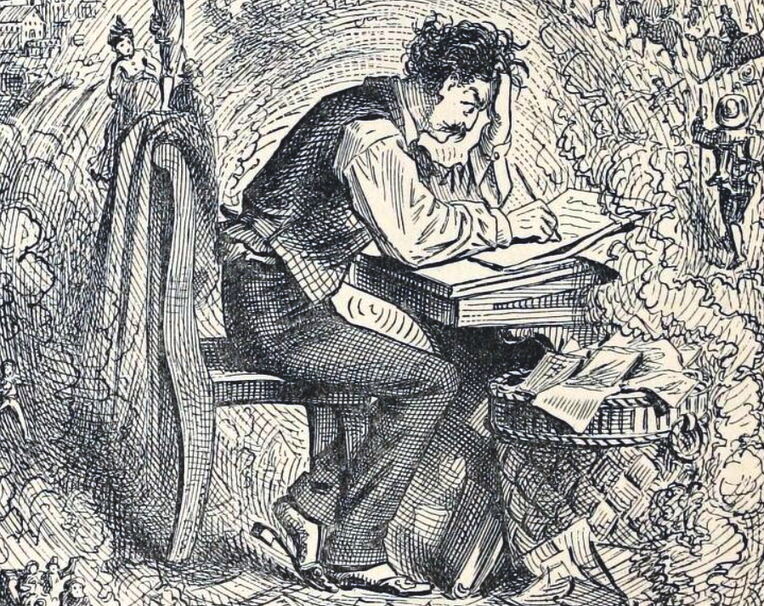
Vernichtender hätte das Urteil nicht sein können: München sei »der furchtbarste, der ödeste, der unerträglichste Ort«, schrieb Mark Twain im November 1878 nach seiner Ankunft in der bayerischen Landeshauptstadt in einem Brief.
Ruf Münchens sah die Welt für den amerikanischen Autor nur wenig später wieder so rosig aus, dass sich die Vorstellung, den ganzen Winter hier zu verbringen vom Albtraum in Vergnügen verwandelte. Schuld an dem prompten Stimmungswechsel war vor allem eine Münchner Wirtsfrau: Caroline Dahlweiner führte in der Karlsstraße eine Pension, in der sich das Ehepaar Twain mit den beiden kleinen Töchtern Suzy und Clara in Begleitung einer Freundin und eines Kindermädchens einmieteten. Das resolute Fräulein Dahlweiner war dafür bekannt, ihre Gäste so herzlich und aufmerksam zu betreuen, dass auch die Twains alle auf der Anreise aus Italien erlittene Unbill schnell vergaßen.
Der Schriftsteller und seine Reisegefährtinnen waren etliche Monate zuvor über den Atlantik geschippert und von Hamburg aus durch Deutschland, in die Schweiz und weiter bis nach Rom gereist. Von dort wollten sie dann im Oktober zurück in deutsche Gefilde fahren, um den Winter in München zu verbringen. Die Reise gen Norden hatte sich allerdings als wahrer Horrortrip entpuppt, mit zwölfstündigen Gewaltfahrten in rumpelnden Postkutschen, Gasthöfen in denen keine Zimmer reserviert waren, und das ungastliche Novemberwetter mit Dauerregen hatte den Weltenbummlern dann noch den Rest gegeben. Einige ordentliche Mützen Schlaf – und Fräulein Dahlweiner sorgten allerdings dafür, dass sich die neuen Gäste aus Connecticut in Windeseile »sauwohl« fühlten – und Mark Twain in München genau die Umstände vorfinden sollte, die ihm den so dringend benötigten, kreativen Schub geben.
Der 43-jährige Bestsellerautor steht trotz seiner jüngsten Erfolge – die 1876 veröffentlichten »Abenteuer des Tom Sawyer« waren ein Riesenhit – mächtig unter Druck, denn sein Verleger wartet schon längst auf ein neues Buch – und hat bislang noch so gut wie gar nichts zu Papier gebracht. Schuld an dieser Situation ist skurrilerweise der Erfolg seiner letzten Romane: Die spülen ihm zwar ordentlich Geld aufs klamme Konto, doch der Rummel, den ein Bestseller gemeinhin mit sich bringt, ist Twain mehr als zuwider. 1878 flieht er deshalb nach Europa, in der Hoffnung, dort die Ruhe und gleichzeitig Anregungen zu finden, die er zum Schreiben braucht – und genau das sollte Twain in München finden.
Der Autor und Übersetzer Michael Klein hat in seinem 2015 erschienen Büchlein »Mark Twain in München« die Erlebnisse des US-Amerikaners während seines Aufenthalts 1878/79 nachgezeichnet. Die Reise damals ist nicht die erste, die Twain in die Alte Welt führt, bereits zehn Jahre zuvor ist er mit dem Schiff durch Europa und den Nahen Osten geschippert, und auch in seiner Heimat ist er viele Jahre kaum länger am gleichen Ort geblieben, was zum größten Teil finanzielle Gründe hatte.
1835 im Städtchen Florida imBundesstaat Missouri in ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen (gestorben 21.4.1910), hatte Samuel Clemens, wie Twain mit bürgerlichem Namen hieß, nach dem frühen Tod des Vaters zunächst eine Lehre als Schriftsetzer bei einer örtlichen Zeitung begonnen. Als sein älterer Bruder ein Konkurrenzblatt kauft, beginnt Twain dort erste Artikel zu veröffentlichen. Ab 1852 reist er als Schriftsetzer und Journalist durch den Osten und Mittleren Westen der USA, verdient aber nie genug Geld, um sich länger über Wasser zu halten. 1855 heuert er deshalb als Lotsenlehrling auf einem Mississippidampfer an und arbeitet einige Jahre in seinem neuen Beruf, bis der Ausbruch des Sezessionskriegs 1861 die Schifffahrt auf dem Mississippi zum Erliegen bringt.
Nach einer zweiwöchigen Stippvisite beim Militär versucht sich Twain als Goldgräber in Nevada – was ihm aber zu anstrengend ist, worauf er sich auf seine Anfänge als Journalist besinnt und wieder zu schreiben beginnt, hauptsächlich Reisereportagen. 1863 benutzt er dazu erstmals das Pseudonym »Mark Twain«, das er allerdings nicht selbst erfunden, sondern von einem kurz darauf verstorbenen Journalistenkollegen geklaut hat, der wie der nunmehrige Mark Twain ebenfalls in der Flussschifffahrt unterwegs war. Der Name »Mark Twain« steht verballhornt für den Fachausdruck »Mark two«, übersetzt »zwei Fäden«, die damalige Maßeinheit für die Wassertiefe.
Der neue Name bringt allerdings nicht automatisch den ersehnten Erfolg als Autor und Twain gerät in eine schlimme Lebenskrise, die ihn sogar zu Selbstmordgedanken treibt. Am Ende rappelt er sich jedoch wieder auf und schafft mit dem 1869 erschienenen Reisebuch »Die Arglosen im Ausland«, in dem er seine Erlebnisse auf der ersten Europareise schildert, den ersehnten Durchbruch.
Auch privat stabilisieren sich seine Verhältnisse: 1870 heiratet der dann 35-Jährige die zehn Jahre jüngere Olivia Langdon und bekommt mit ihr drei Töchter. Der zunehmende Rummel bringt jedoch seine Rastlosigkeit zurück und die Familie beschließt, nach Europa zu reisen.
Dass die Twains den Winter ausgerechnet in München verbringen, hat einen guten Grund: Die Stadt ist wegen ihres Angebots an Museen und Akademien ein bei Kunstfreunden aus aller Welt beliebtes Ziel und die Touristen schätzen nicht nur die kulinarischen Schmankerl und Sehenswürdigkeiten, sondern auch die Ungezwungenheit, mit denen sich Einheimische und Fremde begegnen.
Ein mit der Familie befreundetes Schriftstellerehepaar war ebenfalls schon in München zu Gast gewesen und von ihnen stammt auch der Tipp, unbedingt bei Caroline Dahlweiner abzusteigen, die in den USA schon fast so etwas wie eine Berühmtheit ist, nachdem eine Berufskollegin Twains, die Autorin Helen Hunt, ihr sogar eine eigene Erzählung gewidmet hat, in der sie die 62-Jährige als »beste, liebste, fröhlichste Gastwirtin ganz Deutschlands« beschreibt. Die heimelige Atmosphäre in der Pension, die auch Mark Twain und seine Familie erleben, steht dabei in scharfem Kontrast zu den Eindrücken, die der Autor von der Architektur in der Münchner Innenstadt hat, die er als ungefällig, ja beinahe schon beängstigend erlebt: »Der Eingang unseres Hauses erschien von der Straße her wie eine Scheune, und wenn man die Treppen erstiegen hatte, lagen die Flure in solcher Dunkelheit, dass man kaum zwei Meter weit sehen konnte und, puuh, wie es in ihnen nach den Toiletten roch«, klagte er in einem Brief an seine Schwiegermutter.
Die Häuser rund um seine Unterkunft seien mit Bewohnern vollgestopfte, riesige Blöcke, von denen sich bis zu einem Dutzend um einen kleinen Hinterhof mit einer Wasserzapfsäule scharten – eine Kanalisation und damit auch Leitungen für fließendes Wasser und Abwasser gab es damals in München noch nicht. Die Familie Twain trank deshalb wohlweislich nur in Flaschen abgefülltes Mineralwasser, um nicht Gefahr zu laufen, sich womöglich eine der gefürchteten Infektionskrankheiten wie Cholera oder Typhus zuzuziehen. Um dem Gewusel und dem damit verbundenen Lärm an der Karlstraße zu entfliehen, hatte sich Mark Twain zum Arbeiten ein Zimmer in der Nymphenburgerstraße gemietet, in das er jeden Tag am späten Vormittag, dicht eingehüllt in einen warmen Pelz, zu Fuß marschiert.
Während Twain anfangs um jedes neue Wort in seinem Skript ringt, stürzen sich Gattin Livy und deren Freundin samt den kleinen Töchtern kopfüber in den Münchner Alltag, was ihnen relativ leicht fällt, da die beiden Frauen, ebenso wie Twain selbst, schon gut Deutsch sprechen. Doch die beiden Amerikanerinnen sind ehrgeizig und wollen ihre Sprachkenntnisse weiter vertiefen, weshalb sie verstärkt Kontakt zu einheimischen Familien suchen. Mit Streifzügen durch die Stadt, dazu noch Unterrichtsstunden im Malen und Zeichnen und Besuchen bei ihrer stetig wachsenden Schar an Freunden, ist der Tag der beiden Frauen gut gefüllt. Auch Mark Twain fühlt sich trotz seiner immer noch bestehenden Schreibblockade pudelwohl – und ist für seine Umgebung nur voll des Lobes: »Die Grundeigenschaft der Deutschen scheint Freundlichkeit und Güte den Menschen gegenüber zu sein« – eine Eigenschaft, die er weder in Italien, noch in Frankreich in dieser Art erfahren habe, schwärmt er.
Was ihm an der bayerischen Bevölkerung besonders gefällt, ist deren unverblümte Vorliebe für Kraftausdrücke: Twain liebt Flüche über alles – sehr zum Ärger seiner Frau – und schwelgt geradezu in deutschen Ausdrücken wie »verdammt« oder »Mein Gott«, wobei er angesichts der Schwierigkeiten der deutschen Grammatik für Ausländer gleich wieder eine Gelegenheit zum Fluchen gefunden hat: »Gottverdammte Sprache, gottverdammte Sprache, in der eine Rübe ein Geschlecht hat, eine junge Lady aber nicht«, klagt er spottend, um dann im nächsten Atemzug auch noch den Satzbau durch den Kakao zu ziehen: Deutsch bestehe aus einem Dutzend Wortteilen, »die in einen achteckigen Zylinder geschmissen werden – schaut sie euch gut an, bevor ihr die Maschine zum Drehen bringt, denn ihr werdet sie in ihrer Einfachheit nie wieder sehen – niemals, niemals mehr. Die Maschine dreht sich mit lauter vorangestellten oder angehängten Ver's und Be's und Ge's und Er's und lein's und schen's und gung's und heit's und keit's und zu's und Tausenden anderen, blitzenden und leuchtenden Präfixes und Affixes und Interjektionen.«
Twain analysiert aber nicht nur abstrakte Eigentümlichkeiten der deutschen Sprache und Kultur: Regelmäßig verlässt er sein stilles Schreibgemach, um auf Erkundungstouren kreuz und quer durch die Stadt zu marschieren, auf der Suche nach alltäglichen Begebenheiten, die er in seinem Buch verbraten könnte. Tatsächlich begegnet ihm dabei für einen Amerikaner so manches besonders Erstaunliche, angefangen vom Anblick der tanzenden Schäffler, über die in der Adventszeit die Kinder heimsuchenden Krampusse, bis hin zu den Wäldchen mit Weihnachtsbäumen, die sich plötzlich allenthalben in der Stadt finden.
All die aufregenden Eindrücke erfüllen ihren Zweck: Kurz nach Neujahr ist die Schreibblockade wie weggewischt und in den folgenden Wochen schreibt Twain wie im Rausch Hunderte von Seiten an Erzählungen, die 1880 unter dem Titel »Bummel durch Europa« erscheinen. Eines der darin verarbeiteten Münchner Erlebnisse bezieht sich beispielsweise auf einen Besuch im Leichenschauhaus auf dem Alten Südfriedhof, das der Autor als besonders skurril empfindet, denn dort liegen Dutzende von Toten aufgebahrt – und alle mit einem Glöckchen versehen, falls einer von ihnen wieder aufwachen sollte und sich dann bemerkbar machen könnte – eine Reaktion auf die damals ausgeprägte Angst, womöglich lebend begraben zu werden.
Trotz der angenehmen und aufregenden Monate endet der Aufenthalt der Twains in der Residenzstadt Ende Februar 1879 ziemlich abrupt. Eigentlich hätten sie noch bis Mitte März bleiben wollen, doch Suzy und Clara sind seit Wochen immer wieder erkältet und die Eltern fürchten, dass sich die beiden Mädchen beim rauen Münchner Klima womöglich eine Lungenentzündung zuziehen könnten, weshalb kurz entschlossen die Koffer gepackt werden und die Familie früher als geplant nach Frankreich weiterreist.
Für Twain und seine Frau wird es kein Abschied für immer aus München sein: 1893 kommen sie noch einmal in die bayerische Landeshauptstadt, doch dieser Aufenthalt steht unter keinem guten Stern: Livy, die nie die robusteste Konstitution hatte, ist gesundheitlich so angeschlagen, dass ein hiesiger Arzt ihr dringend rät, sofort aufzubrechen und einen Kurort aufzusuchen, was das Paar auch macht und nach Tölz weiterzieht.
An die glücklichen Monate, die er in jenem Winter 1878/79 in der bayerischen Landeshauptstadt verbrachte, sollte sich der Bestsellerautor aber ein Leben lang erinnern, ganz besonders an die kulinarischen Leckereien – und die »Bavarian Gemütlichkeit«.
Susanne Mittermaier
Quelle: Michael Klein: Mark Twain in München. Heidelberg, 2015.
16/2022



