Jagd- und Musikleidenschaft der letzten Bayerischen Herzöge
Ein kleiner Einblick in das Schaffen Orlando di Lassos im Kontext seiner Zeit – Teil II



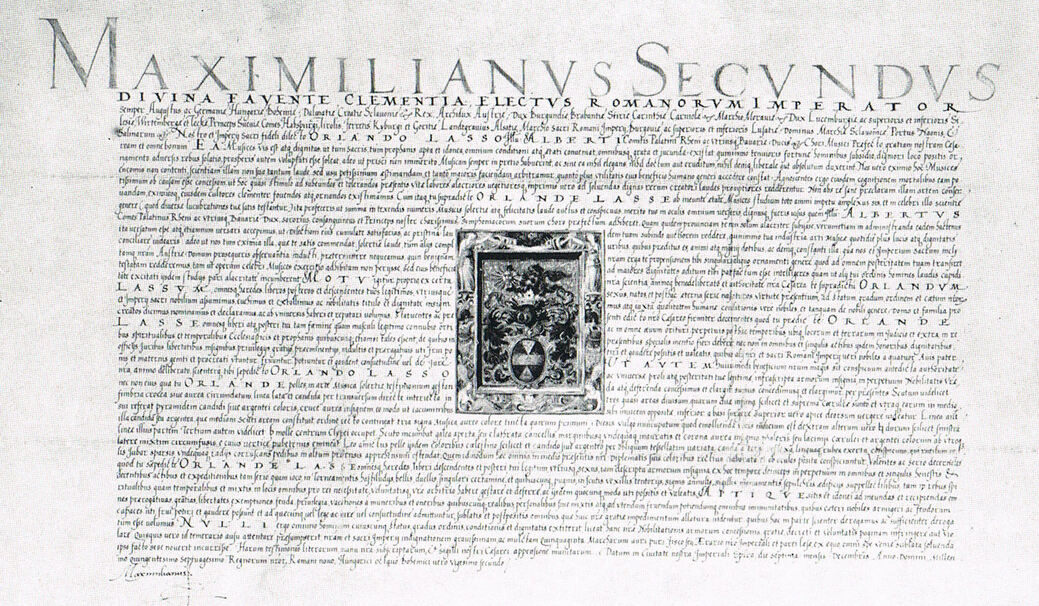
Es muss schon ein sehr lukratives Angebot gewesen sein, das Orlando di Lasso veranlasste, andere verlockende Offerten aus europäischen Machtzentren auszuschlagen, wie beispielsweise Paris, Wien oder Neapel, um letztlich zum bayerischen Herzogshof an die Isar zu wechseln. Als Lasso im Herbst 1556, ursprünglich als Tenorist in die Kapelle eintrat, hatte er schon als 24-jähriger Künstler mit seinen frühen Chansons und dem Antwerpener Motettenbuch hohe Wertschätzung errungen. Aus Münchner Sicht kam der Wechsel gerade zum richtigen Zeitpunkt, zumal in der »26 Canntoreypersonen und 12 khnaben« umfassenden Kapelle ein ziemliches Durcheinander herrschte. Offenbar fehlte es seit dem Tod Ludwig Senfls (verstorben 1543) an einer Persönlichkeit, die den Kapellkorpus zusammenhielt. Eine Respektsperson mit gewisser Popularität konnte da sicher nicht schaden, um Ordnung in die Reihen und in die interne Struktur zu bringen.
Zwietracht und tätliche Handlungen in der Hofkapelle
Ob Lasso allerdings mit solch massiven Problemen an seinem neuen Wirkungsort gerechnet hat, bleibt dahingestellt. Denn deren gab es mehr als genug. Die angeführten Missstände reichten jedenfalls von »vilerlay Zwitracht vnnd vnainigkhait« bis hin »zu thätlicher Hanndlung vnnd Leibs Beschedigung (!)«, um nur einige zu nennen. Angesichts solcher Disziplinlosigkeit sah sich Herzog Albrecht V. genötigt, ein strenges Dekret zur »Reformation vnnd Ordnung der Fürstlichen Bayrischen HofCapellen vnnd Canntorej Zu München« auszugeben. Trotzdem blieben Meinungsverschiedenheiten in der Folgezeit nicht aus,was wohl der unterschiedlichen Herkunft, Sozialisierung sowie des Temperaments der angeworbenen Sänger und Musiker, vornehmlich aus Italien, den Niederlanden und Spanien geschuldet war. Was wiederum sieben Jahre später eine ergänzende Instruktion unter Mitarbeit Lassos erforderte.
Abgesehen von den internen Problemen gelang es Lasso in seiner frühen Münchner Periode, die Hofkapelle in der Herzogsstadt Landshut aufzubauen. Zwischen beiden Städten entwickelte sich bald eine gesunde Rivalität und Lasso dürfte damals oft hin und her gereist sein. Als man die Hochzeit des Erbprinzen Wilhelm mit Renata von Lothringen vorbereitete, bemühte sich Lasso um einen neuen und besseren Status beider Kapellen, die ja dann 1568 auch vereinigt eingesetzt wurden. Da Lasso viele Reisen unternahm, sei es zur Anwerbung neuer Musiker und Sänger oder zur Beschaffung geeigneter Instrumente, verfügte er standesgemäß über den Luxus eines »Dienstwagens mit zwei PS« samt Diener. So liest man im Zahlamtsbuch der Jahre 1571/72 (Bayr. Kreisarchiv München) unter der Rubrik »Fuerschlag aufs Lifergellt«: Canntorej: Orlandus Capellmaister 400 fl. (Florin Gulden) für ain diener Costgellt 40 fl., Fueter aufs Pferdt bezahlt. In dieser Auszahlungsliste sind auch sämtliche Mitglieder der Hofkapelle aufgeführt, angefangen von den »Geygen« über Organisten, Trompetenkorps, Hofpauckher bis hin zu den Discantisten: Deren seindt es 16.« Summa der Cantorejbesoldung 5878 fl. Zu erwähnen ist noch, dass im fürstlichen Marstall 182 Pferde zu versorgen waren.
Summer- und winnter Claidt für Sinnger und Instrumentalisten
Für die Wertschätzung der Musiker und Hofbediensteten gibt das »Verzaichnis der Hofclaider aus der fürstlichen Schneidereej« interessante Hinweise. So standen den Cammer- und Hofräth, Sekretären, Kanzleipersonen, Einspännige Knechte, Stallbuben sowie den Mitgliedern der Hofkapelle und Kantorei je ein Kleid für Sommer und Winter zu, natürlich in der Hierarchie und Ausgestaltung abgestuft. Unter allen Musikern beanspruchte Orlando das Doppelte der Norm. Für die kleinere Hofkapelle der Prinzenresidenz in Landshut galten dieselben Regeln wie für ihre Münchner Kollegen. Kostbar waren die Edelknaben ausgestattet. Jeder von ihnen erhielt ein »Claidt« für 37 fl. 30 kr. Am bescheidensten waren die »Torwarten zue Landshuet« mit 3 fl. 20 kr., während die Kantoreiknaben ebenso wie die Musiker mit jeweils 20 fl. zu Buche schlugen – etwa der selbe Wert wie für die Hofkapläne. Zum Vergleich: für Doctores medicinae wurden nur 13 fl. ausgegeben, für Zahlmeister elf und der Kalkant am Blasbalg erhielt ein Kleid für 5 fl. 55 kr. Wenn Maestro Orlando in späteren Auflistungen nicht mehr erscheint, so dürfte er bereits sein eigenes Ehrkleid aus kaiserlichem Geschenk getragen haben. Zu den bevorzugten Stoffen, die in der fürstlichen Schneiderei verarbeitet wurden, zählten »Lindisch tuech« (feines, weiches Leinen), »Samat« (Samt), »Purchat« (Brokat), »Parchet« (grober Wollstoff), »Leinbat« (Batist) sowie Futtertuch und Steppseiden. Als Tuchmaß rechnete man das damals gebräuchliche »Lott«.
Herkunft und Erziehung der Chorknaben
Eine wichtige Aufgabe fiel Lasso mit der Heranbildung des Nachwuchses der Kapelle zu. Es blieb jederzeit sein besonderes Anliegen, die Singknaben musikalisch und in den humanistischen Wissenschaften zu fördern, selbst wenn sie mit Einsetzen ihrer Mutation (Stimmbruch) bald wieder mit dem Kanzlistenvermerk »abgefertigt« in die Welt hinausgeschickt wurden. Andere wiederum wurden in der Kapelle weiterbeschäftigt. Eine strenge Abgrenzung der zum vokalen und zum instrumentalen Dienst eingesetzten Knaben ist nicht möglich, da Lasso auf eine universale Ausbildung bedacht war. Die meisten Lassoschüler errangen später andernorts bedeutende Stellungen, wie Leonhard Lechner, Johannes Eccard oder Mathies Schwertfüren in Salzburg.
Dass Lasso mit seiner Gemahlin Regina Wäckinger, (ihre Mutter Margarethe war Kammerfrau der Herzogin Maria Maximiliana, einer Schwester Wilhelms V.), viele Jahre hindurch mehrere dieser »Pueri« in seinem Haus bewirtet hat, ist bekannt. Es war zu der Zeit üblich, dass auch Mitglieder der Kapelle die welschen Kantoreiknaben mit Kost und Logis versorgten. Die Kostbeiträge, die der Herzog dafür ausgab, waren keineswegs gering. Anfangs dürfte Lasso hauptsächlich Knaben aus seiner Heimat angeworben haben, so die vier »Niederlenndischen Khnaben«, die in den Zahlbüchern vermerkt sind. Auch die hygienischen Erfordernisse wurden nicht außer Acht gelassen. So soll der Kapellmeister ihre Liegestatt sauber halten, ihr Gewand zu rechter Zeit waschen und sie »zum wenigsten In dreyen wochen ain mal padn und seubern lassen,« wie es in der herzoglichen Anordnung heißt. Für das notdürftige Wärmen der Stuben erhielten die Erzieher »Holzgeltt.«
Das Geschäft mit Verschnidtnen Khnaben
Seit etwa 1580 wurden in der Münchner Kapelle auch »verschnidtne Khnaben« aufgenommen. Es war der Trend der Zeit. Der Zustrom solcher jugendlicher »Eunucchijs« hielt etwa dreißig Jahre an. Schon um 1600 scheint sich aber die soziale Stellung der Kastraten verschlechtert zu haben. Zuerst waren diese Kräfte für den Diskant (oberste Stimmlage) sehr begehrt, obwohl Wilhelm V. nicht gerade Sympathien für die »Castraten« hegte, die er als »ein wunder ungeschaffen Mensch« bezeichnete. Und sie waren begehrt bei ihren Begleitpersonen, heute würde man sagen »Schleppern«, die im Sog dieser Entwicklung ihrerseits das große Geschäft mit dem herzoglichen Hofe witterten.
Den Eintragungen zufolge kamen viele aus dem Ausland, jedoch konnte nicht jeder mit der Billigung Lassos rechnen, insbesonderewenn »sie die stim und Musicam nit annehmen wollen,« also seinem geforderten Niveau nicht entsprachen. Selbst für diese Fälle wurden ihre »Manager« aus dem herzoglichen Säckel für ihre fragwürdigen Lieferdienste nebst Zehrung für den Heimweg entlohnt.
Auffallend ist in den Zahlbüchern die Häufung von »hergebrachten« Knabenkastraten aus der bayerischen Nachbarschaft, die um die Jahre 1590/91 einsetzte. Selbst der Landrichter von Schärding, die Pfleger zu MosPurg (Moosburg), Khäzting (Kötzting) und Gerolfing bringen solche Knaben zu Lasso. Und auch der einfache Landmann witterte seine Chance, wie etwa der Paursmann aus der Hofmarch Aijing oder Eustachien Zarstorffer, im Treunstainer Lanndgericht seßhaft beweisen, die ebenfalls mit »verschnittnen khneblein« anrückten. Dies also ein eindeutiger Hinweis darauf, dass auch der Chiemgau nicht ausgenommen war.
Lasso legte bis in seine letzten Lebensjahre großes Augenmerk auf die konstante Zahl der Chorknaben und die damit verbundene, strenge Obhut, wobei er infolge Krankheit immer mehr auf den Veroneser Priester Jacobo Perlatio in seiner Funktion als Praeceptor (Erzieher) vertrauen musste. Zwei Jahre vor seinem Tod erlitt der Maestro einen plötzlichen Schlaganfall, dessen Folgen die Orlandin in ihrer häuslichen Not wie folgt beschreibt: »…wie ich von geising haim khumen, er mich nit hat wöllen kennen oder mit mir oder schier mit niemandt wellen Rätten (reden)«. Trotzdem unternimmt er 1594 mit dem herzoglichen Gefolge seine allerletzte Reise zum Reichstag nach Regensburg.
Orlando di Lasso stirbt am 14. Juni 1594 und wird im Friedhof St. Salvator beerdigt, der 1789 aufgelassen wurde.Das Epitaph wird im Bayerischen Nationalmuseum verwahrt. Zwei seiner Söhne, Ferdinand und Rudolph treten ebenfalls mit eigenen Kompositionen in Erscheinung. An den begnadeten Musiker und Komponisten der Renaissance erinnert heute eine stattliche Bronzestatue am Münchner Promenadenplatz, die er sich mittlerweile mit Michael Jackson, dem »King of Pop« teilt. Treue Fans halten mit Blumen und Fotos und anderen Devotionalien die Erinnerung an den Chartstürmer der Neuzeit aufrecht, der öfters im Bayerischen Hof nächtigte.
So kommen gleich zwei Musikgiganten zu posthumen Ehren, die der Nachwelt – jeder auf seine Art – grandiose, musikalische Dauerbrenner hinterlassen haben.
Ludwig Schick
Quellen: Wolfgang Boetticher: Aus Orlando di Lassos Wirkungskreis, Ruhpoldinger Heimatbuch.
Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 42 vom 21. 10. 2023
43/2023



