»Ich bin der Landschaft anhänglich...«
Wahl-Bayer Thomas Mann: übers Gedenkjahr hinaus präsent
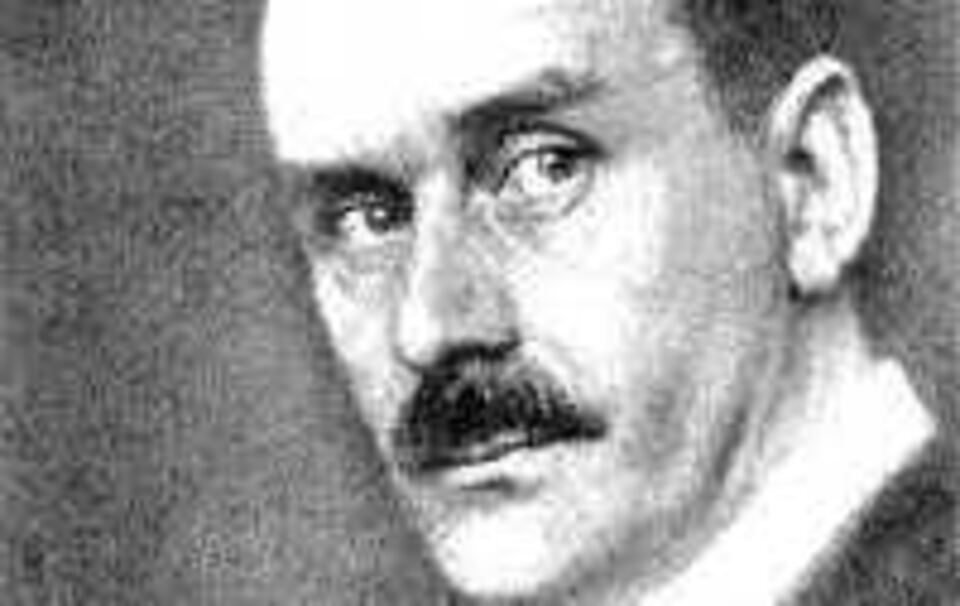
Porträt Thomas Mann
Seine Kinder nannten ihn den »Zauberer«: Thomas Mann, den wohl am nachhaltigsten von der literarischen Welt gefeierten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Dass T.M., wie ihn Tochter Erika abzukürzen pflegte, beinahe vier Jahrzehnte in Bayern lebte, vornehmlich in München, dabei viel durch bayerische Lande reiste und sich, beispielsweise in Bad Tölz, ein Anwesen erwarb; dass gerade in München für das Gesamtwerk Thomas Manns entscheidende Arbeiten entstanden, wurde durch so manche neuere Veröffentlichung – ob Zeitungsbericht, Essay oder Buch – gerade im Thomas-Mann-Gedenkjahr 2005 erst so richtig publik.
Der »Zauberer«
2005 galt deshalb als ein echtes »Thomas-Mann-Jahr«, weil der Nobelpreisträger von 1929 im Jahre 1875, also vor 130 Jahren, (in Lübeck) zur Welt kam, 1905, also vor 100 Jahren, (in München) Katia Pringsheim ehelichte (mit der er sechs Kinder haben sollte, Erika schon gleich im Hochzeitsjahr) und 1955, also vor genau einem halben Jahrhundert, (in Zürich) den Tod fand. Anlässe genug also, 2005 Thomas Mann zu gedenken: seines Lebens, seiner Sippschaft, seines Werkes und Wirkens, dabei betont jener Jahre, in denen er – von 1894 bis 1933 – in Bayern »zauberte«.
»Der Wille zum Glück«
In München trat der 19-jährige Thomas Mann, der Mutter Julia und den Geschwistern Julia, Carla und Viktor ein Jahr später, 1894, hierher gefolgt war, bei der »Süddeutschen Feuerversicherungsbank« als Volontär ein. An der TH war er eine Zeitlang Gasthörer, um Journalist zu werden. In der Zeitschrift »Simplicissimus« veröffentlichte er 1896 die Erzählung »Der Wille zum Glück«, ein Jahr später zwei Novellen in der »Neuen Deutschen Rundschau«, das Jahr darauf sieht ihn schon als Lektor beim »Simplicissimus«. Wegen Untauglichkeit aus dem im Oktober 1900 angetretenen Militärdienst nach wenigen Wochen entlassen, begann T.M. »Buddenbrooks«, den Roman, der seit seinem Erscheinen 1901 bei S. Fischer den Namen des großen Erzählers Thomas Mann in alle Welt trug.
Die »Buddenbrooks« wurden nicht, wie lange Zeit angenommen, im Haus Giselastraße 15, sondern in der Feilitzschstraße, Hausnummer 32, beendet. Die dort 2002 angebrachte gläserne Gedenktafel trägt die ersten und die drei letzten im Roman gesprochenen Worte: »Was ist das« und »Es ist so«. Ein Erstwort Thomas Manns aber hat geradezu Münchner Geschichte gemacht: »München leuchtete«. So lautet der Anfang der 1902 herausgebrachten Novelle »Gladius Dei«. Im Weinlokal Heinrich Eckel, Theresienstraße 23, las T.M. aus dem Manuskript am 18. November 1901: eine Hymne an die Kunstmetropole München. Hier blühten Kunst, Musik und – die Bohème, deren Hochburg »Schwabylon« war. Rauschende Feste und gesellschaftlich attraktive Matineen und Soireen lockten das begüterte Bürgertum in die großen Säle und intimen Salons. Der junge T.M. ging auf im damaligen literatur-offenen Schwabing, nahm hier mehrere Wohnungen kurz hintereinander und ließ sich bald als »Buddenbrook«-Verfasser allüberall hofieren. Er sang ein Loblied auf den Münchner Jugendstil, den jüdisch-bayerischen Kunsthandel und vor allem das »Odeon«, den weltbekannten Konzertsaal der Münchner Klassikliebhaber, von dem noch heute so mancher Greis schwärmt, dem der »Gasteig« vergleichsweise viel zu trutzig und akustisch nicht annähernd so gut erscheint.
»Herr und Hund«
So sehr T.M. in jungen Schriftstellerjahren (»Tonio Kröger«, die Künstlernovelle, schreibt er zwischen 1900 und 1902 als die »Geschichte seines eigenen Sehnens und Trachtens, seiner frühen Schülerliebe zu Armin Martens« (D. Heißerer) in der Schellingstraße) Schwabing und das südliche Münchner Umland mit seinen Seen und Alpenpanoramen liebte, so fest verankert war er doch in München. Seinen »Zaubergarten« (in Anspielung auf Klingsors Reich aus Richard Wagners »Parsifal«, 1882) fand er im Herzogpark, dem Revier, »das der Besitzer der Villa Poschingerstraße 1 auf unzähligen Spaziergängen mit Hühnerhund Bauschan erkundet hat, um es im Idyll ‘Herr und Hund’ (entstanden 1919, d. Verf.) zu verewigen«, wie sich A. v. Schirnding (in einer SZ-Rezension) besinnt. »Das ist kein Wald«, schrieb T.M., »und kein Park, das ist ein Zaubergarten ... Ich will das Wort vertreten, obwohl es sich im Grunde um eine karge, eingeschränkte und zur Krüppelhaftigkeit geneigte Natur handelt, die mit ein paar einfachen botanischen Namen erschöpft und bezeichnet ist ... Ich bin der Landschaft anhänglich und dankbar, darum habe ich sie beschrieben. Sie ist mein Park und meine Einsamkeit; meine Gedanken und Träume sind mit ihren Bildern vermischt und verwachsen, wie das Laub ihrer Schlingpflanzen mit dem ihrer Bäume ...«
Am 7. Juni 1925 – der »Zauberer« hatte gut ein halbes Jahr zuvor seinen großen Wurf, den mehrmals verfilmten Roman »Der Zauberberg«, bei S. Fischer in Berlin publiziert – fand eine Matinee zu Ehren des Fünfzigjährigen im Münchner Residenztheater statt. Da hatte er, nach eigenem Bekunden, eine Anwandlung, nämlich selbst Parsifal zu sein, ein »staunender« Tor also »von einem Reigen lieblicher Blumenmädchen umschwebt, von denen eine mir gar einen Lorbeerkranz aufs Haupt zwingen wollte ...« Das gelang dem süßen Wesen allerdings nicht. T.M. hatte es dazu nicht kommen lassen (wollen). T.M.-Tagebuch-Kenner ahnen, weshalb. Gewiss war dem Wahlbayern T.M. noch die Bescheidenheit als ein ihm angeborener Wesenszug eigen. Jedoch: T.M. hätte sich viel lieber von einem »Münchner Kellner, hübsch« (Notiz vom 25. Juni 1950) wie dem »Franzl« Westermeier zum Dichterfürsten auf der Bühne krönen lassen, dessen strahlend weiße Zähne und zarten Hände ihn so sehr reizten, dass ihn allein der Anblick des jungen Mannes erotisierte, den ihm das Schicksal noch fünf Jahre vor seinem Tod (im Zürcher Grand Hotel Dolder) zuführen sollte.
»Noch nie so traurig gewesen«
T.M.s Zeit in Bayern war nicht nur von Triumphen und Erfolgen als Literat erfüllt, sondern durchaus auch von Niederlagen, Krisen, Sorgen, Selbstzweifeln, familiären Desasters. In Polling ging Schwester Carla, erpresst von einem Schürzenjäger der übelsten Sorte, 1910 freiwillig aus dem Leben. »Ich glaube nicht«, schrieb T.M., »dass ich in meinem Leben schon einmal so traurig gewesen bin«. Von einem fehlgeschlagenen Kuraufenthalt in Dresden suchte er sich nicht weniger als von persönlichen Schwierigkeiten des ersten Ehejahres in Oberammergau zu erholen. Probleme gab es – und die begleiteten den Vater Thomas Mann ein Leben lang – mit den eigenen Kindern genug. Mit Erika, deren Liaisons ebenso zum Scheitern verurteilt wie ihre beruflichen Ambitionen als Schauspielerin, Literatin, Kabarett-Gründerin und Journalistin von Krisen gebeutelt waren. Mit Klaus (geboren 1906), der zwar als Autor (Roman »Mephisto« 1936) hohes Ansehen errang, sich aber als (schwuler) Intellektueller weder in Nazi-Deutschland noch in Amerika durchsetzten konnte und 1949 nach einer Überdosis Schlaftabletten in Cannes starb. Vielleicht mehr noch mit dem Jüngsten, Michael (geboren 1919), dem Ungeliebten, Ungewollten, dessen Abtreibung gerade noch verhindert wurde, der sich als einer der ersten mit des Vaters Tagebüchern befasste und eine bescheidene Karriere als Universitätsdozent in Kalifornien machte, die 1977 mit Barbituraten, vermischt mit Alkohol aus der ins Arbeitsköfferchen eingebauten Whisky-Bar ein jähes Ende fand. Für das Ausschweifende – so wird etwa in der Erzählung »Mario und der Zauberer« (1930) deutlich, hatte der Herr Papa selbst durchaus etwas übrig ...
Das »Villino«
Glücklich mag der »Zauberer«, ein Leben lang hin und her gerissen zwischen ehelichen Pflichten und homoerotischen Begierden, in jenen Jahren gewesen sein, die ihm den Rückzug ins beschauliche »Villino« in Feldafing zur Abfassung seines »Zauberbergs« ermöglichten. 1912 im englischen Baustil errichtet, barg das Häuschen, das heute auf dem Gelände der Fernmeldeschule der Bundeswehr steht, den Dichter bei vierzehn Aufenthalten. Am 9. Mai 1921 konnte hier, in der hinter dem Tusculum gelegenen »Laube«, Band 1 des »Zauberbergs« abgeschlossen werden.
»‘habt!«
Kein Wunder, dass gerade im ausgeklungenen T.M.-Gedenkjahr 2005 mehrere Ausstellungen über »die Manns« zu registrieren waren. Zwei von ihnen, die in München zu sehen waren, reichten über das Gedenkjahr hinaus. Die in der U-Bahn-Galerie im nördlichen Aufgang der Station »Universität« über Erika Mann (»Beteiligt euch, es geht um eure Erde«) und die im Literaturhaus am Salvatorplatz (»Die Kinder der Manns – Ansichten einer Familie«). Unbekanntes aus den Nachlässen (von Erika und Klaus, die ständig die »Monacensia« birgt, aber auch von den Kindern Elisabeth, Michael und Monika) wurde, zum größten Teil erstmals, einer breiten Öffentlichkeit vorgeführt. Schirmherr der großen Literaturhaus-Schau, die gewissermaßen einen Schluss-Strich unter das Thomas-Mann-Gedenkjahr 2005 zog, war der Münsteraner Professor Frido Mann, Lieblingsenkel des »Über-Großvaters«, der ihn liebevoll »Echo« nannte, ihn, den Nepomuk Schneidewein aus dem im amerikanischen Exil entstandenen, 1947 bei Bermann-Fischer in Stockholm publizierten autobiographischen Roman »Doktor Faustus«. Hatte Frido/Echo von einer Sache genug, pflegte er kurz »‘habt!« zu sagen. Das fand T.M. bravourös. »Wenn ich sterbe«, schrieb er 1943 in einem Brief an den Dirigenten Bruno Walter, »werde ich auch ‘habt!’ sagen«.
Hans Gärtner
Literatur:
Dirk Heißerer: »Im Zaubergarten. Thomas Mann in Bayern«, München (C.H. Beck) 2005
Inge und Walter Jens: »Katias Mutter. Das außerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim«, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2005
Galerie Gerda Bassenge, Berlin: Katalog zur Auktion 81: Aus dem Werk Thomas Manns. Slg. Dr. Horst Säcker u. a. Beitr., April 2003. - Die Fotos zu diesem Beitrag sind dankbar dieser Publikation entnommen.
Hermann Kurzke: »Thomas Mann«. Das Leben als Kunstwerk«, Frankfurt a. M. (Fischer TB) 2001
Edo Reents: »Thomas Mann«, München (Claassen) 2001
9/2006
Der »Zauberer«
2005 galt deshalb als ein echtes »Thomas-Mann-Jahr«, weil der Nobelpreisträger von 1929 im Jahre 1875, also vor 130 Jahren, (in Lübeck) zur Welt kam, 1905, also vor 100 Jahren, (in München) Katia Pringsheim ehelichte (mit der er sechs Kinder haben sollte, Erika schon gleich im Hochzeitsjahr) und 1955, also vor genau einem halben Jahrhundert, (in Zürich) den Tod fand. Anlässe genug also, 2005 Thomas Mann zu gedenken: seines Lebens, seiner Sippschaft, seines Werkes und Wirkens, dabei betont jener Jahre, in denen er – von 1894 bis 1933 – in Bayern »zauberte«.
»Der Wille zum Glück«
In München trat der 19-jährige Thomas Mann, der Mutter Julia und den Geschwistern Julia, Carla und Viktor ein Jahr später, 1894, hierher gefolgt war, bei der »Süddeutschen Feuerversicherungsbank« als Volontär ein. An der TH war er eine Zeitlang Gasthörer, um Journalist zu werden. In der Zeitschrift »Simplicissimus« veröffentlichte er 1896 die Erzählung »Der Wille zum Glück«, ein Jahr später zwei Novellen in der »Neuen Deutschen Rundschau«, das Jahr darauf sieht ihn schon als Lektor beim »Simplicissimus«. Wegen Untauglichkeit aus dem im Oktober 1900 angetretenen Militärdienst nach wenigen Wochen entlassen, begann T.M. »Buddenbrooks«, den Roman, der seit seinem Erscheinen 1901 bei S. Fischer den Namen des großen Erzählers Thomas Mann in alle Welt trug.
Die »Buddenbrooks« wurden nicht, wie lange Zeit angenommen, im Haus Giselastraße 15, sondern in der Feilitzschstraße, Hausnummer 32, beendet. Die dort 2002 angebrachte gläserne Gedenktafel trägt die ersten und die drei letzten im Roman gesprochenen Worte: »Was ist das« und »Es ist so«. Ein Erstwort Thomas Manns aber hat geradezu Münchner Geschichte gemacht: »München leuchtete«. So lautet der Anfang der 1902 herausgebrachten Novelle »Gladius Dei«. Im Weinlokal Heinrich Eckel, Theresienstraße 23, las T.M. aus dem Manuskript am 18. November 1901: eine Hymne an die Kunstmetropole München. Hier blühten Kunst, Musik und – die Bohème, deren Hochburg »Schwabylon« war. Rauschende Feste und gesellschaftlich attraktive Matineen und Soireen lockten das begüterte Bürgertum in die großen Säle und intimen Salons. Der junge T.M. ging auf im damaligen literatur-offenen Schwabing, nahm hier mehrere Wohnungen kurz hintereinander und ließ sich bald als »Buddenbrook«-Verfasser allüberall hofieren. Er sang ein Loblied auf den Münchner Jugendstil, den jüdisch-bayerischen Kunsthandel und vor allem das »Odeon«, den weltbekannten Konzertsaal der Münchner Klassikliebhaber, von dem noch heute so mancher Greis schwärmt, dem der »Gasteig« vergleichsweise viel zu trutzig und akustisch nicht annähernd so gut erscheint.
»Herr und Hund«
So sehr T.M. in jungen Schriftstellerjahren (»Tonio Kröger«, die Künstlernovelle, schreibt er zwischen 1900 und 1902 als die »Geschichte seines eigenen Sehnens und Trachtens, seiner frühen Schülerliebe zu Armin Martens« (D. Heißerer) in der Schellingstraße) Schwabing und das südliche Münchner Umland mit seinen Seen und Alpenpanoramen liebte, so fest verankert war er doch in München. Seinen »Zaubergarten« (in Anspielung auf Klingsors Reich aus Richard Wagners »Parsifal«, 1882) fand er im Herzogpark, dem Revier, »das der Besitzer der Villa Poschingerstraße 1 auf unzähligen Spaziergängen mit Hühnerhund Bauschan erkundet hat, um es im Idyll ‘Herr und Hund’ (entstanden 1919, d. Verf.) zu verewigen«, wie sich A. v. Schirnding (in einer SZ-Rezension) besinnt. »Das ist kein Wald«, schrieb T.M., »und kein Park, das ist ein Zaubergarten ... Ich will das Wort vertreten, obwohl es sich im Grunde um eine karge, eingeschränkte und zur Krüppelhaftigkeit geneigte Natur handelt, die mit ein paar einfachen botanischen Namen erschöpft und bezeichnet ist ... Ich bin der Landschaft anhänglich und dankbar, darum habe ich sie beschrieben. Sie ist mein Park und meine Einsamkeit; meine Gedanken und Träume sind mit ihren Bildern vermischt und verwachsen, wie das Laub ihrer Schlingpflanzen mit dem ihrer Bäume ...«
Am 7. Juni 1925 – der »Zauberer« hatte gut ein halbes Jahr zuvor seinen großen Wurf, den mehrmals verfilmten Roman »Der Zauberberg«, bei S. Fischer in Berlin publiziert – fand eine Matinee zu Ehren des Fünfzigjährigen im Münchner Residenztheater statt. Da hatte er, nach eigenem Bekunden, eine Anwandlung, nämlich selbst Parsifal zu sein, ein »staunender« Tor also »von einem Reigen lieblicher Blumenmädchen umschwebt, von denen eine mir gar einen Lorbeerkranz aufs Haupt zwingen wollte ...« Das gelang dem süßen Wesen allerdings nicht. T.M. hatte es dazu nicht kommen lassen (wollen). T.M.-Tagebuch-Kenner ahnen, weshalb. Gewiss war dem Wahlbayern T.M. noch die Bescheidenheit als ein ihm angeborener Wesenszug eigen. Jedoch: T.M. hätte sich viel lieber von einem »Münchner Kellner, hübsch« (Notiz vom 25. Juni 1950) wie dem »Franzl« Westermeier zum Dichterfürsten auf der Bühne krönen lassen, dessen strahlend weiße Zähne und zarten Hände ihn so sehr reizten, dass ihn allein der Anblick des jungen Mannes erotisierte, den ihm das Schicksal noch fünf Jahre vor seinem Tod (im Zürcher Grand Hotel Dolder) zuführen sollte.
»Noch nie so traurig gewesen«
T.M.s Zeit in Bayern war nicht nur von Triumphen und Erfolgen als Literat erfüllt, sondern durchaus auch von Niederlagen, Krisen, Sorgen, Selbstzweifeln, familiären Desasters. In Polling ging Schwester Carla, erpresst von einem Schürzenjäger der übelsten Sorte, 1910 freiwillig aus dem Leben. »Ich glaube nicht«, schrieb T.M., »dass ich in meinem Leben schon einmal so traurig gewesen bin«. Von einem fehlgeschlagenen Kuraufenthalt in Dresden suchte er sich nicht weniger als von persönlichen Schwierigkeiten des ersten Ehejahres in Oberammergau zu erholen. Probleme gab es – und die begleiteten den Vater Thomas Mann ein Leben lang – mit den eigenen Kindern genug. Mit Erika, deren Liaisons ebenso zum Scheitern verurteilt wie ihre beruflichen Ambitionen als Schauspielerin, Literatin, Kabarett-Gründerin und Journalistin von Krisen gebeutelt waren. Mit Klaus (geboren 1906), der zwar als Autor (Roman »Mephisto« 1936) hohes Ansehen errang, sich aber als (schwuler) Intellektueller weder in Nazi-Deutschland noch in Amerika durchsetzten konnte und 1949 nach einer Überdosis Schlaftabletten in Cannes starb. Vielleicht mehr noch mit dem Jüngsten, Michael (geboren 1919), dem Ungeliebten, Ungewollten, dessen Abtreibung gerade noch verhindert wurde, der sich als einer der ersten mit des Vaters Tagebüchern befasste und eine bescheidene Karriere als Universitätsdozent in Kalifornien machte, die 1977 mit Barbituraten, vermischt mit Alkohol aus der ins Arbeitsköfferchen eingebauten Whisky-Bar ein jähes Ende fand. Für das Ausschweifende – so wird etwa in der Erzählung »Mario und der Zauberer« (1930) deutlich, hatte der Herr Papa selbst durchaus etwas übrig ...
Das »Villino«
Glücklich mag der »Zauberer«, ein Leben lang hin und her gerissen zwischen ehelichen Pflichten und homoerotischen Begierden, in jenen Jahren gewesen sein, die ihm den Rückzug ins beschauliche »Villino« in Feldafing zur Abfassung seines »Zauberbergs« ermöglichten. 1912 im englischen Baustil errichtet, barg das Häuschen, das heute auf dem Gelände der Fernmeldeschule der Bundeswehr steht, den Dichter bei vierzehn Aufenthalten. Am 9. Mai 1921 konnte hier, in der hinter dem Tusculum gelegenen »Laube«, Band 1 des »Zauberbergs« abgeschlossen werden.
»‘habt!«
Kein Wunder, dass gerade im ausgeklungenen T.M.-Gedenkjahr 2005 mehrere Ausstellungen über »die Manns« zu registrieren waren. Zwei von ihnen, die in München zu sehen waren, reichten über das Gedenkjahr hinaus. Die in der U-Bahn-Galerie im nördlichen Aufgang der Station »Universität« über Erika Mann (»Beteiligt euch, es geht um eure Erde«) und die im Literaturhaus am Salvatorplatz (»Die Kinder der Manns – Ansichten einer Familie«). Unbekanntes aus den Nachlässen (von Erika und Klaus, die ständig die »Monacensia« birgt, aber auch von den Kindern Elisabeth, Michael und Monika) wurde, zum größten Teil erstmals, einer breiten Öffentlichkeit vorgeführt. Schirmherr der großen Literaturhaus-Schau, die gewissermaßen einen Schluss-Strich unter das Thomas-Mann-Gedenkjahr 2005 zog, war der Münsteraner Professor Frido Mann, Lieblingsenkel des »Über-Großvaters«, der ihn liebevoll »Echo« nannte, ihn, den Nepomuk Schneidewein aus dem im amerikanischen Exil entstandenen, 1947 bei Bermann-Fischer in Stockholm publizierten autobiographischen Roman »Doktor Faustus«. Hatte Frido/Echo von einer Sache genug, pflegte er kurz »‘habt!« zu sagen. Das fand T.M. bravourös. »Wenn ich sterbe«, schrieb er 1943 in einem Brief an den Dirigenten Bruno Walter, »werde ich auch ‘habt!’ sagen«.
Hans Gärtner
Literatur:
Dirk Heißerer: »Im Zaubergarten. Thomas Mann in Bayern«, München (C.H. Beck) 2005
Inge und Walter Jens: »Katias Mutter. Das außerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim«, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2005
Galerie Gerda Bassenge, Berlin: Katalog zur Auktion 81: Aus dem Werk Thomas Manns. Slg. Dr. Horst Säcker u. a. Beitr., April 2003. - Die Fotos zu diesem Beitrag sind dankbar dieser Publikation entnommen.
Hermann Kurzke: »Thomas Mann«. Das Leben als Kunstwerk«, Frankfurt a. M. (Fischer TB) 2001
Edo Reents: »Thomas Mann«, München (Claassen) 2001
9/2006



