Hartwig Peetz, Rentamtmann und Heimatforscher
Vor 120 Jahren wurde der gebürtige Bayreuther zum Ehrenbürger Traunsteins ernannt
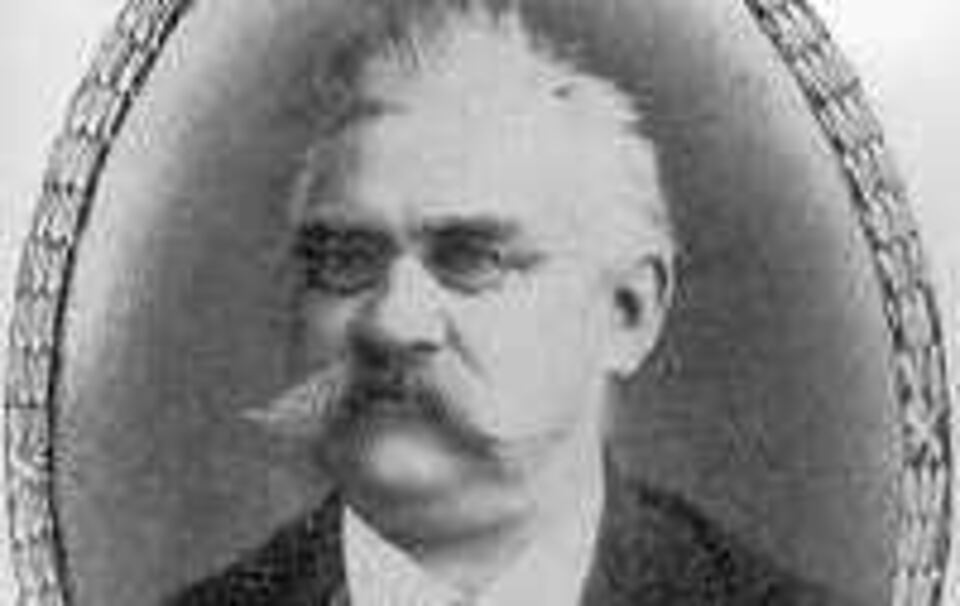
Der große Historiker Karl Bosl hat Hartwig Peetz in seine »Bayrische Biographie« aufgenommen: Er nennt ihn »Heimat- und Geschichtsforscher«, der Vater ist als »Konsistorialbeamter« angeführt. Letzteres hat auch Hartwig Peetz geprägt, ein Konsistorialrat war ein höherer Beamter einer evangelischen Kirchenbehörde, und Hartwig Peetz hat noch von München aus seinen Einfluss geltend gemacht, dass die evangelische Gemeinde in Traunstein ihr eigenes Gotteshaus bekommt. Doch nicht deswegen ist er am 29. November 1882 zum Ehrenbürger Traunsteins ernannt worden, in der Begründung hieß es »mit Rücksicht auf die vielen Verdienste, welche sich der nunmehr von Traunstein scheidende k(öni)gl(iche) Rentamtmann Peetz für Stadt und Land erworben hat«. Das war also vor demnächst 120 Jahren, 60 Jahre zuvor, am 28. März 1822, war Peetz in Bayreuth geboren worden, zehn Jahre nach der Ehrenbürgerwürde, am 17. April 1892, verstarb er in München. Gedenktage zuhauf also, und es ist wahrlich an der Zeit, sich dieses verdienten Mannes zu erinnern, der viel mehr war als ein »Heimat- und Geschichtsforscher«. Heute erinnert die »Hartwig-Peetz-Straße« an den großen Franken, ein kleines Quersträßchen zwischen Jahn- und Josefstraße, und wohl die wenigsten Traunsteiner dürften wissen, nach wem diese Straße benannt ist. Max Fürst hat ihm seinerzeit einen umfangreichen Nekrolog geschrieben, in allen großen südbayerischen, aber auch oberfränkischen Zeitungen wurde sein Tod mit entsprechenden Würdigungen verbreitet. Hartwig Peetz hatte in Bayreuth und dann in München seine humanistischen Studien begonnen, 1842 immatrikulierte er sich an der Universität Erlangen, anfänglich in Theologie, dann aber auch in den Rechtswissenschaften. Seinen Lieblingswunsch, Kunstmaler zu werden – wozu er auch das Talent hatte –, musste er aus Rücksicht auf die familiären Verhältnisse aufgeben: »Die Jugend- und Studienzeit«, schrieb Max Fürst, »legte Peetz manche Entbehrung auf, da er es möglichst vermied, seine Eltern, die außer ihm noch 18 Kinder heranwachsen sahen, mit weiteren materiellen Opfern zu belasten.« Den Unterhalt in München erwarb sich Peetz durch Privatunterricht in angesehenen Häusern, dazu kamen Gönner, die Peetz mit seinem Lebesoptimismus und seinem »Frohsinn« (Max Fürst) nachhaltig beeindruckte. Einer dieser Gönner, so erzählte Hartwig Peetz später in Traunstein, habe ihm den ersten Ausflug auf die Chiemseeinseln ermöglicht, und in einer wahren Gebetsstimmung hätte er »beim entzückenden Anblick all’ der landschaftlichen Schönheit nur den einen Wunsch gehegt, doch in dieser herrlichen Gegend einst leben und wirken zu dürfen«. Sein Herzenswunsch wurde ihm erfüllt, am 1. Oktober 1860 wurde Hartwig Peetz zum Rentamtmann in Traunstein ernannt. Dass der Chiemgau Peetz’ zweite Heimat wurde, hing auch mit einem gnadenlosen Verriss eines populär-historischen Werkes zusammen, das er noch in Bayreuth geschrieben hatte: »Christian, Markgraf von Brandenburg-Bayreuth«. Peetz hatte darin keinerlei Partei ergriffen und versucht, so objektiv wie möglich zu bleiben; ein einflussreicher Bayreuther Konsistorialrat, wie Max Fürst schreibt, sah sich zu »einer überaus herben Kritik des Buches und seines Verfassers« veranlast, was zur Folge hatte, dass Peetz vorläufig darauf verzichtete, die Geschichte Bayreuths weiter zu studieren. Peetz war 1859 nach Trostberg ans Rentamt gekommen, dort entstand seine kleine Schrift »Fischwaid in den bayerischen Seen«, als Leiter des Rentamts Trostberg war ihm auch der Chiemsee unterstellt. König Max II. wurde auf Peetz aufmerksam und erteilte ihm den Auftrag, für die berühmte »Bavaria«, die Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, eine »Ortsgeschichte des ehemaligen Fürstentumes Bayreuth« zu schreiben, eine Aufgabe, die Peetz bravourös löste.
Wie gesagt, im Oktober 1860 kam Peetz nach Traunstein, er blieb 22 Jahre, bis er zum Vorstand des Landratsamtes München ernannt wurde. Schon 1863 wurde er Vorsitzender des landwirtschaftlichen Vereins, ein wesentliches Amt, das er umsichtig und tatkräftig bis 1878 bekleidete. In seinen Traunsteiner Jahren war Hartwig Peetz unermüdlich, als Mitglied und Vorstand der Schützengesellschaft, als einflussreiches Mitglied der evangelischen Gemeinde, als Heimatforscher und Verfasser wesentlicher Schriften, als Singspielautor, als Organisator des 1878 stattfindenden »Schützenfestes«, und, natürlich, auch als Leiter des königlichen Rentamts, des Finanzamtes.
Viele Franken hat man damals in die altbairischen Behörden abkommandiert, sie galten als besonders tüchtig und auch als der Monarchie treu ergeben. Hartwig Peetz können wir uns als jovialen Leiter vorstellen, als einen Mann, der ein Herz für die einfachen Leute hatte und seine »Pappenheimer«, sprich die Gemeindevorsteher, sehr wohl kannte, dennoch hat er gewiss sein wichtiges Amt mit Würde und Akribie wahrgenommen. Man fragt sich heute, woher er die Zeit für seine umfangreichen historischen und heimatkundlichen Studien nahm, für seine Schriften und all die Singspiele für die Traunsteiner Liedertafel, von denen drei erhalten sind: »Sonehild oder die Quellen am Adelholze«, Adelheid von Megling oder die Blutlache am Engelstein« und »Ein Pfahlbau am Chiemsee«, in dem höchst seltsamerweise auch die Argonauten auftauchen. Geschrieben hat er diese Schwänke unter dem Namen »Fremulio« (nach seinem zweiten Vornamen Freimund) »Peziano« oder »Pezzano«, sie sind nicht so wichtig, auch wenn Hartwig Peetz auf recht humorvolle Weise die Chiemgauer Sagenwelt verarbeitete.
Viel bedeutender sind seine wissenschaftlichen Abhandlungen, so »Vom Weiland der ostbairischen Alpwirthe«, »Die Kiemseeklöster« und die »Volkswissenschaftlichen Studien«, um nur die wichtigsten zu nennen. 1885 hielt Peetz vor dem Deutschen Alpenverein in München einen höchst bemerkenswerten Vortrag »Von der Wehrkraft unseres Bergvolkes«, der in seiner ganzen Länge im »Sammler« abgedruckt wurde. Darin arbeitete Peetz auch die alte bayerisch-preußische Feindschaft auf, die 1866 eskaliert war; er zeigte sich jedoch als begeisterter, ja glühender Reichsfreund, er rechtfertigte Bismarck und sein Tun als eine Leistung im höheren Sinne, denn über allem stand ja die Reichsgründung von 1871. Ob er dabei auch an Ludwig Thomas »Krawall« dachte? Die Wege der beiden haben sich in Traunstein nicht geschnitten, aber auch Thoma war Mitglied derselben Schützenvereinigung, für die Peetz 1878 das größte historische Fest organisiert hatte, das Traunstein bis dato gesehen hatte.
Das »400-jährige Jubiläum der Schützengilde zu Traunstein«, wohl ein »konstruiertes Jubiläum«, wie Götz von Dobeneck 1992 im »Heimatspiegel« schrieb (»mit solchen Jubiläen war man in Traunstein immer großzügig«), gilt bis heute als die »Geburtsstunde« der Traunsteiner Festumzüge: Den Hauptteil, so Götz von Dobeneck, »bildete ein von Peetz gestalteter historischer Festzug mit Gruppen aus fünf Jahrhunderten. Die Kostüme lieh man sich vom Hoftheater in München«.
Im Traunsteiner Stadtarchiv sind noch Fotos vorhanden; doch, das alles erinnert an die historischen Gruppen des heutigen Georgiritts, und fürwahr: Mit den beiden Fürsts hatte auch Hartwig Peetz engste Verbindungen, der 1892 – in Peetz’ Todesjahr – erstmals wieder aufgeführte Georgiritt ging ja auf eine Initiative des damaligen Stadtpfarrermesners Oswald Fürst, des Bruders von Max Fürst, zurück. Und Hartwig Peetz’ Tochter Irene, 1868 in Traunstein geboren, schrieb bekanntlich den Text zum Lied des Schwertertanzes, der 1926 zum ersten Mal aufgeführt wurde.
13 Jahre vor dem Schützenfest hatte Hartwig Peetz im »Traunsteiner Wochenblatt« eine 19 Kapitel umfassende Serie zu »Traunstein und seine Umgebung« veröffentlicht. Es waren kurzweilige und dennoch fundierte Beiträge, in die Peetz auch recht humorvolle Anekdoten eingestreut hatte, wie überhaupt sein Humor bestens ausgebildet sein musste. Die Erzählungen vom »Chiemgauer Volk« sind heute nicht nur eine volkskundliche Rarität, sie sagen in ihrer humorigen und launigen Schreibe mehr über die Chiemgauer als so manche wissenschaftlichen Studien. 1871 hatte Peetz einen allseits als angemessen empfundenen Nachruf auf den großen Heimatforscher Johann Josef Wagner geschrieben; auf Peetz dürfte auch die Petition zurückgehen, mit der Traunsteiner und Chiemgauer versuchten, die Abholzung auf der Herreninsel durch ein württembergisches Konsortium zu stoppen. Als König Ludwig II. 1873 dann die Herreninsel gekauft hatte, trotz erheblicher Bedenken und wohl nur, weil ihm sein Schlossbau auf einer Insel im Staffelsee verwehrt worden war, verfasste Hartwig Peetz die Dankadresse an den Monarchen, die 20 Chiemgaugemeinden unterzeichnet hatten.
1871 schon war Peetz mit dem »Michaelsorden« ausgezeichnet worden; als er 1882 seine Zelte in Traunstein abbrechen musste, ernannten ihn die Stadtoberen zum Ehrenbürger. 1910, fast 20 Jahre nach seinem Tod, setzte ihm die Schützengilde, die »Königlich Privilegierten Feuerschützen«, beim Schützenhaus nahe des heutigen Soldatenfriedhofs oberhalb des Veitsgroms einen Gedenkstein in Anerkennung der Verdienste, die er sich um den Verein erworben hatte.
Hoch geachtet ist Hartwig Peetz auch nach wie vor in der evangelischen Kirchengemeinde Traunstein: Als oberfränkischer Protestant und als Konsistorialratssohn setzte er sich dafür ein, dass die – noch kirchenlose – evangelische Gemeinde ihre Gottesdienste im Saal des Traunsteiner Rathauses abhalten durfte. Es sollte noch bis 1899 dauern, bis die Traunsteiner »Lutheraner« ihr eigenes Gotteshaus erhielten.
Hartwig Peetz hat das nicht mehr erlebt. Er starb eines raschen, plötzlichen Todes mit 70 Jahren, höchst angesehen, auch bewundert. Er muss ein herausragender Mensch gewesen sein, ein Mensch, der sich für alles interessierte und darüber seine humanitäre Einstellung nicht vergaß.
22 Jahre lang hat er in Traunstein, das ihm zur echten zweiten Heimat geworden war, gewirkt und bedeutende Spuren hinterlassen, auch nach seiner Beförderung nach München war er mit seiner Familie immer wieder in den Chiemgau und nach Traunstein zurückgekehrt. Auf dem vor dem Schützenhaus stehenden Gedenkstein steht unter anderem:
»Als Forscher des Chiemgaus Leuchte,
Als Bürger Traunsteins Stolz,
Als Schützenfreund ein echter Deutscher,
dem Besten zu Gedenken.«
Das entstand 1910 und war getragen von der patriotischen Strömung dieser Zeit, aber es trifft auf Hartwig Peetz bestens zu.
Traunstein kann tatsächlich auf diesen großen Mann stolz sein.
WS
40/2002
Wie gesagt, im Oktober 1860 kam Peetz nach Traunstein, er blieb 22 Jahre, bis er zum Vorstand des Landratsamtes München ernannt wurde. Schon 1863 wurde er Vorsitzender des landwirtschaftlichen Vereins, ein wesentliches Amt, das er umsichtig und tatkräftig bis 1878 bekleidete. In seinen Traunsteiner Jahren war Hartwig Peetz unermüdlich, als Mitglied und Vorstand der Schützengesellschaft, als einflussreiches Mitglied der evangelischen Gemeinde, als Heimatforscher und Verfasser wesentlicher Schriften, als Singspielautor, als Organisator des 1878 stattfindenden »Schützenfestes«, und, natürlich, auch als Leiter des königlichen Rentamts, des Finanzamtes.
Viele Franken hat man damals in die altbairischen Behörden abkommandiert, sie galten als besonders tüchtig und auch als der Monarchie treu ergeben. Hartwig Peetz können wir uns als jovialen Leiter vorstellen, als einen Mann, der ein Herz für die einfachen Leute hatte und seine »Pappenheimer«, sprich die Gemeindevorsteher, sehr wohl kannte, dennoch hat er gewiss sein wichtiges Amt mit Würde und Akribie wahrgenommen. Man fragt sich heute, woher er die Zeit für seine umfangreichen historischen und heimatkundlichen Studien nahm, für seine Schriften und all die Singspiele für die Traunsteiner Liedertafel, von denen drei erhalten sind: »Sonehild oder die Quellen am Adelholze«, Adelheid von Megling oder die Blutlache am Engelstein« und »Ein Pfahlbau am Chiemsee«, in dem höchst seltsamerweise auch die Argonauten auftauchen. Geschrieben hat er diese Schwänke unter dem Namen »Fremulio« (nach seinem zweiten Vornamen Freimund) »Peziano« oder »Pezzano«, sie sind nicht so wichtig, auch wenn Hartwig Peetz auf recht humorvolle Weise die Chiemgauer Sagenwelt verarbeitete.
Viel bedeutender sind seine wissenschaftlichen Abhandlungen, so »Vom Weiland der ostbairischen Alpwirthe«, »Die Kiemseeklöster« und die »Volkswissenschaftlichen Studien«, um nur die wichtigsten zu nennen. 1885 hielt Peetz vor dem Deutschen Alpenverein in München einen höchst bemerkenswerten Vortrag »Von der Wehrkraft unseres Bergvolkes«, der in seiner ganzen Länge im »Sammler« abgedruckt wurde. Darin arbeitete Peetz auch die alte bayerisch-preußische Feindschaft auf, die 1866 eskaliert war; er zeigte sich jedoch als begeisterter, ja glühender Reichsfreund, er rechtfertigte Bismarck und sein Tun als eine Leistung im höheren Sinne, denn über allem stand ja die Reichsgründung von 1871. Ob er dabei auch an Ludwig Thomas »Krawall« dachte? Die Wege der beiden haben sich in Traunstein nicht geschnitten, aber auch Thoma war Mitglied derselben Schützenvereinigung, für die Peetz 1878 das größte historische Fest organisiert hatte, das Traunstein bis dato gesehen hatte.
Das »400-jährige Jubiläum der Schützengilde zu Traunstein«, wohl ein »konstruiertes Jubiläum«, wie Götz von Dobeneck 1992 im »Heimatspiegel« schrieb (»mit solchen Jubiläen war man in Traunstein immer großzügig«), gilt bis heute als die »Geburtsstunde« der Traunsteiner Festumzüge: Den Hauptteil, so Götz von Dobeneck, »bildete ein von Peetz gestalteter historischer Festzug mit Gruppen aus fünf Jahrhunderten. Die Kostüme lieh man sich vom Hoftheater in München«.
Im Traunsteiner Stadtarchiv sind noch Fotos vorhanden; doch, das alles erinnert an die historischen Gruppen des heutigen Georgiritts, und fürwahr: Mit den beiden Fürsts hatte auch Hartwig Peetz engste Verbindungen, der 1892 – in Peetz’ Todesjahr – erstmals wieder aufgeführte Georgiritt ging ja auf eine Initiative des damaligen Stadtpfarrermesners Oswald Fürst, des Bruders von Max Fürst, zurück. Und Hartwig Peetz’ Tochter Irene, 1868 in Traunstein geboren, schrieb bekanntlich den Text zum Lied des Schwertertanzes, der 1926 zum ersten Mal aufgeführt wurde.
13 Jahre vor dem Schützenfest hatte Hartwig Peetz im »Traunsteiner Wochenblatt« eine 19 Kapitel umfassende Serie zu »Traunstein und seine Umgebung« veröffentlicht. Es waren kurzweilige und dennoch fundierte Beiträge, in die Peetz auch recht humorvolle Anekdoten eingestreut hatte, wie überhaupt sein Humor bestens ausgebildet sein musste. Die Erzählungen vom »Chiemgauer Volk« sind heute nicht nur eine volkskundliche Rarität, sie sagen in ihrer humorigen und launigen Schreibe mehr über die Chiemgauer als so manche wissenschaftlichen Studien. 1871 hatte Peetz einen allseits als angemessen empfundenen Nachruf auf den großen Heimatforscher Johann Josef Wagner geschrieben; auf Peetz dürfte auch die Petition zurückgehen, mit der Traunsteiner und Chiemgauer versuchten, die Abholzung auf der Herreninsel durch ein württembergisches Konsortium zu stoppen. Als König Ludwig II. 1873 dann die Herreninsel gekauft hatte, trotz erheblicher Bedenken und wohl nur, weil ihm sein Schlossbau auf einer Insel im Staffelsee verwehrt worden war, verfasste Hartwig Peetz die Dankadresse an den Monarchen, die 20 Chiemgaugemeinden unterzeichnet hatten.
1871 schon war Peetz mit dem »Michaelsorden« ausgezeichnet worden; als er 1882 seine Zelte in Traunstein abbrechen musste, ernannten ihn die Stadtoberen zum Ehrenbürger. 1910, fast 20 Jahre nach seinem Tod, setzte ihm die Schützengilde, die »Königlich Privilegierten Feuerschützen«, beim Schützenhaus nahe des heutigen Soldatenfriedhofs oberhalb des Veitsgroms einen Gedenkstein in Anerkennung der Verdienste, die er sich um den Verein erworben hatte.
Hoch geachtet ist Hartwig Peetz auch nach wie vor in der evangelischen Kirchengemeinde Traunstein: Als oberfränkischer Protestant und als Konsistorialratssohn setzte er sich dafür ein, dass die – noch kirchenlose – evangelische Gemeinde ihre Gottesdienste im Saal des Traunsteiner Rathauses abhalten durfte. Es sollte noch bis 1899 dauern, bis die Traunsteiner »Lutheraner« ihr eigenes Gotteshaus erhielten.
Hartwig Peetz hat das nicht mehr erlebt. Er starb eines raschen, plötzlichen Todes mit 70 Jahren, höchst angesehen, auch bewundert. Er muss ein herausragender Mensch gewesen sein, ein Mensch, der sich für alles interessierte und darüber seine humanitäre Einstellung nicht vergaß.
22 Jahre lang hat er in Traunstein, das ihm zur echten zweiten Heimat geworden war, gewirkt und bedeutende Spuren hinterlassen, auch nach seiner Beförderung nach München war er mit seiner Familie immer wieder in den Chiemgau und nach Traunstein zurückgekehrt. Auf dem vor dem Schützenhaus stehenden Gedenkstein steht unter anderem:
»Als Forscher des Chiemgaus Leuchte,
Als Bürger Traunsteins Stolz,
Als Schützenfreund ein echter Deutscher,
dem Besten zu Gedenken.«
Das entstand 1910 und war getragen von der patriotischen Strömung dieser Zeit, aber es trifft auf Hartwig Peetz bestens zu.
Traunstein kann tatsächlich auf diesen großen Mann stolz sein.
WS
40/2002



