Domherr Johann Baptist Aingler
Der Teisendorfer Mühlmachersohn war ein Förderer des Schulwesens

Domherr Johann Baptist Aingler (1780-1829). Ölgemälde von Joh. Baptist Neumüller, dat. 1825. Gang zur Dombibliothek in Freising. Diözesanmuseum Freising, Inv.Nr. D 12124a.

Das Hazn-Gütl auf der Öd bei Teisendorf, auch beim »Mühlmacher« genannt. (Baulicher Zustand vor 1920). Geburtshaus des Domherrn J.B. Aingler.
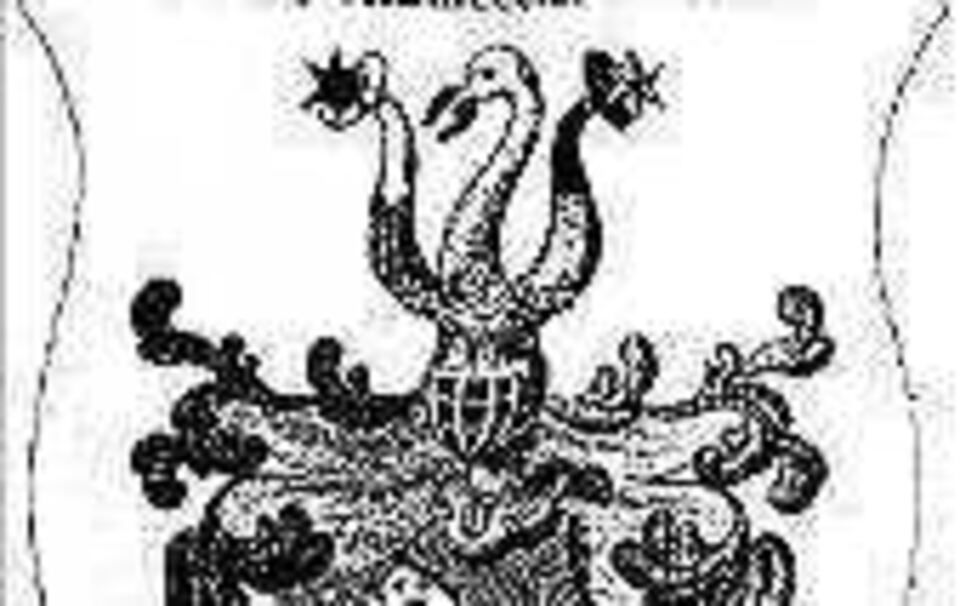
Wappen welches J.B. Aingler als Generalvisitator der Erzdiözese München-Freising führte.
Im Gang zur Bibliothek auf dem Freisinger Domberg trifft man auf ein 76 mal 103 cm großes Ölgemälde, dass bereits auf dem ersten Blick einen hohen geistlichen Würdenträger erkennen läßt. Nicht nur weil er sich dem Betrachter im vollständigen klerikalen Kleid eines Münchener Metropolitankanonikers präsentiert, auch sein Platz zwischen den frühen Bischöfen der 1817 neu organisierten Diözese weist eindeutig darauf hin.
Dem Maler des Bildes wird man sogleich ein Höchstmaß an Detailgenauigkeit der Konterfeikunst attestieren. Im Signum stellt sich heraus: Das Bild wurde 1825 von dem Vachendorfer Johann Baptist Neumüller angefertigt. Neumüller genoss zuvor ein Privatstipendium des ersten bayerischen Königs Max I. Joseph an der Münchner Kunstakademie und stand ab 1823 weit über dem Chiemgau hinaus, in einem guten Ruf als ausgezeichneter Portraitist und Maler von Sakralbildern. Dass nun der Abgebildete, wie auch der Maler, ihren Weg durch die südostbayerische Region nahmen und sich deshalb ihre Lebenslinien eines Tages kreuzten, stellte sich erst heraus, nachdem sich die Biographie des geistlichen Herrn auf dem Bild aus den noch vorhandenen Schriftquellen langsam herauszuschälen begann.
Dabei trat eine ganz außergewöhnliche Klerikerpersönlichkeit aus dem Dunkel des Vergessenseins. Ein Mann voller Tatkraft und geistiger Frische, ein selbstloser Streiter und Vorkämpfer für ein sozialgerechtes Schulwesen, dessen geistliche Karriere wohl noch weitergegangen wäre, hätte nicht eine unheilvolle Krankheit jäh sein Leben beendet.
Johann Baptist Aingler
Priester und Inspektor der Salzburger Waisenhäuser, Direktor des dortigen Lehrerseminars, Dekan und Lokalschulinspektor von Mittersil, Pfarrer und Schulförderer von Kirchdorf bei Aibling, Pfarrer und Prodekan von Haslach-Traunstein, Dompfarrer von München, Generalvisitator der Erzdiözese München-Freising.
Ein Lebensbild, das sich lohnte, genauer zu verfolgen.
In wahrlich schlichtester bäuerlicher Umgebung erblickte Johann Baptist Aingler am 8.Juni 1780 auf dem Hazn-Gütl in Öd bei Teisendorf das Licht der Welt. Sein Vater nannte sich Thomas Aingler. Er stellte im Nebenerwerb zur Landwirtschaft hölzerne Getreide-Abputzmühlen her, weshalb das Anwesen später den Namen »beim Mühlmacher« erhielt. Seine Mutter hieß Gertraud und war eine geborene Hogger.
Da seine Eltern schon 1758 bei der Hofübernahme verheiratet waren, ist anzunehmen, dass der kleine Johann Baptist ein später »Nachzügler« von mehreren vorgeborenen Geschwistern war, den das kleine Anwesen nur schwerlich hätte ernähren können. Deshalb kam er schon sehr früh von zuhause weg, zu Verwandten in Maria Pfarr im Lungau, die für einen ersten grundlegenden Unterricht des aufgeweckten Buben sorgten.
Seine bestechende Intelligenz öffneten ihm den Weg zu einer philosophischen und theologischen Ausbildung am Salzburger Klerikalseminar. Inmitten der Wirren der Säkularisation empfing Aingler am 4. Juni 1803 in Salzburg die Priestenweihe.
Bereits auf den ersten Sprossen seiner Karriereleiter ließ Aingler erkennen, wie sehr ihm das Schulwesen nahestand. Als Katechet und Inspektor der beiden Salzburger Waisenhäuser wurde der erst sechsundzwanzigjährige Teisendorfer auf Vorschlag des damaligen Direktors des Lehrerseminars Vierthaler, zu dessen Nachfolger bestellt. Als solcher verbesserte er die Ausbildung der Lehramtskandidaten durch weitsichtige organisatorische Maßnahmen. Schon damals begann er, finanzielle Engpässe durch Beiträge aus seinem Einkommen zu überbrücken.
Als ihm 1813 auf Grund seiner in Salzburg erworbenen Verdienste die Pfarrei Mittersil im Pinzgau anvertraut wurde, sah er sich sogleich in erschreckender Weise mit den Niederungen des damaligen Dorfschulwesens konfrontiert. Dort unterrichtete ein alter Lehrer, sein Weib und deren kleine Tochter die Schule. Die Mittersiler Zustände waren so gravierend, dass sie sogar als Negativbeispiel in einer Glosse in den Salzburger Literaturzeitung Beachtung fanden.
Der Schreiber bemerkte: »Die Kinder lasen in elenden Scharteken elendiglich, ohne Ordnung, ohne Zusammenhang, ohne die geringste Spur einiges Nachdenkens. Der Inhalt der Verschriften, die ihnen der Schulmeister vorlegte, waren die 7 Todsünden. Im Sommer blieb die Schule geschlossen, weil keine Kinder kommen, sagte der Schulmeister. Weil der Schulmeister keinen Unterricht erteilet, sagte die Gemeinde.«
Um es kurz zu machen. Aingler, der dem neu organisierten Dekanl- und Pfarramt Mittersil auch als Dekan und Lokalschulinspektor vorstand, machte aus der desolaten Pinzgauer Dorfschule in wenigen Jahren ein vielbeachtetes Aushängeschild.
Schon bei seinem Amtsantritt hielt er eine Predigt über die Vorteile und Notwendikeit einer guten Schulerziehung. Darin forderte er die Jugend zum fleißigen Schulbesuch auf und eröffnete im Herbst des Jahres 1813 die neue Schule von Mittersil.
In Zusammenarbeit mit dem dortigen Landrichter regte er die Gründung einer Verpflegungsanstalt für arme Kinder an, welche eine so große Unterstützung fand, dass die Bedürftigen nicht blos die Mittagskost erhielten, sondern auch für deren Einkleidung gesorgt wurde. Auf einem Bewertungsbogen, über Ainglers seelsorgerische und schulische Tätigkeit im Pinzgau, der im Diözesanarchiv in München verwahrt wird, heißt es: Hat sich als Dekan volle Zufriedenheit erworben, merkbar besseren Geistes als einen rühmlichen Volkslehrer bewiesen, durch unermüdete Anstrengung für Unterricht und Bildung der Jugend, vereinigt mit einer Unterstützung armer Kinder .... sich sohin ein unvergessliches Denkmal gesetzt.«
Als seine Geburtsheimat, der Rupertiwinkl, dem Königreich Bayern angegliedert wurde, bekannte sich der »Wahlsalzburger« auf seine Wurzeln und beantragte nach sechsjähriger, fruchtbarster Tätigkeit im Salzburger Land, eine Versetzung in eine bayerische Pfarrei.
Am 17. Juni 1819 wurde dem Wunsch des Kirchenmannes stattgegeben. Ein Dreivierteljahr später wurde Aingler in die Pfarrei Kirchdorf bei Aibling versetzt. Mit diesem Wechsel wurde er gleichzeitig in die Diözese Freising inkarniert. Auch in Kirchdorf bemühte er sich sofort um die Hebung des Schul- und Erziehungswesens. Unter seiner Ägide wurde ein neues, zweckmäßiges Schulhaus errichtet.
Wie in Mittersil, so ließ Aingler auch in Kirchdorf erhebliche Mittel für schulische Zwecke einfließen, »nicht mit geringem eigenen Kostenaufwande«, wie der Kleinhelfendorfer Distriktschulinspektor Krauß zu bestätigen wusste. Selbst das Landgericht Miesbach, dem die Pfarrei Kirchdorf politisch angehörte, stimmte über Ainglers relativ kurze Amtstätigkeit von gerade einmal zweieihalb Jahren, wahre Lobeshymnen an.
Die hervorragenden Referenzen aus dem Wirkungsstätten des rührigen Schulorganisators drangen bis an die höchsten Stellen des Ordinariats.
Doch ehe man Aingler für höhere Aufgaben vorschlug, stellte man ihn auf eine harte Bewährungsprobe. Er sollte die Pfarrei Haslach-Traunstein übernehmen, und die Zerwürfnisse zwischen Pfarrei und Stadtmagistrat, die sich während der Amtszeit seines Vorgängers Lorenz Zoglauer zu einer unüberbrückbaren Verhandlungskluft um die Pfarrsitzverlegung ausgedehnt hatten, wieder beseitigen helfen. Es mag Aingler ein gewisses Unbehagen nachgegangen sein, als er am 24. Juli 1822 in den schloßähnlichen Pfarrhof von Haslach eingezogen ist. Nun befand er sich ohne eigenes Wollen in einem Gärtopf von Intrigen und Machtkämpfen, von städtischen und ländlichen Positionierungen. Das ausgleichende Wesen Ainglers bewirkte es allerdings, dass in den zwei Jahren, welchem er Stadt und Land als Prodekan vorstand, das Schiff der Großpfarrei wieder in ruhigere Fahrwasser kam. Für solchermaßen wertvolle Dienste an einer so heiß umkämpften Front, verlieh ihm Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel 1823 den Titel des Geistlichen Rates.
Doch nun nahmen die Dinge plötzlich einen ganz anderen Lauf. Als 1824 auf allerhöchste kgl. Anweisung der Münchner Domherr Ignaz Albert Riegg zum Bischof von Augsburg ernannt wurde, galt es die zehnte Kanonikatsstelle des Domkapitels wieder zu besetzen. Auf Befehl seiner Majestät des Königs von Bayern Max. I. Joseph, wurde nun der Haslacher Pfarrer und Prodekan Johann Baptist Aingler in das Kapitelgremium von zehn Geistlichen der Metropolitankirche zu »Unserer Lieben Frau« in München aufgenommen. Das Ernennungsdekret und ein Begleitschreiben, in dem Erzbischof Lothar Anselm seine persönliche »besondere Wertschätzung« für den Ernannten zum Ausdruck brachte, wurden Aingler am 26. Juni 1824 durch einen Kurier im Haslacher Pfarrhof präsentiert. Am 28. Januar 1825 wurde der neue Domherr zusammen mit zwei anderen Chorbrüdern in der Münchner Frauenkirche aufgeschworen.
Im selben Jahr noch, ließ sich Aingler von Neumüller, den er während seiner Amtszeit in Haslach kennen und als Maler schätzen gelernt hatte, im festlichen Chorkleid portraitieren. Es zeigt den 45-jährigen Kanoniker in selbstbewusster würdevoller Haltung. Über dem Hermelin trägt er einen Bandorden.
In der rechten Hand hält er das Birett. Seine Linke ruht in der Schleife seiner Schärpe. Neumüller stellte den hochrangigen Kirchenmann Aingler mit festentschlossenen, aber gütigen Blick dar. Trotz aufgesetzter ernster Mine, lässt sein Gesichtsausdruck verhaltene Züge eines humorvollen Menschen durchscheinen.
Ein Jahr später wurde Aingler das Amt des Generalvisitators der Diözese angetragen. In dieser Eigenschaft bereiste er zusammen mit Gebsattel mehrere Dekanate u.a. auch im Chiemgau.
Dieser Umstand könnte möglicherweise zu einer erneuten Begegnung mit dem Vachendorfer Maler geführt haben, denn im Diözesanarchiv befindet sich ein weiteres Bild Neumüllers, dessen Weg dorthin einige Rätsel aufgibt. Es stellt eine sehr eindrucksvolle Ölbergszene dar, vom Maler eigenhändig signiert und auf das Jahr 1826 datiert. Das dieses Bild der Hinterlassenschaft Ainglers entstammt, erscheint angesichts des Entstehungsdatums als sehr warscheinlich.
Als Generalvisitator führte Aingler ein Wappen, dessen Bezug zum Wappenführer kaum zu verstehen ist.
Ainglers Position im Münchner Domkapitel muss als sehr bedeutend eingeschätzt werden. Dem Gremium der stets zehn Metropolitanchorherren entwuchsen während der Zeit seines Kanonikates sage und schreibe drei Bischöfe.
Wer weiß, wie Ainglers eigene Karriere verlaufen wäre, hätte ihm nur seine Gesundheit mitgespielt.
Bereits am 20.4. des Jahres 1829 wurde er nur neunundvierzigjährig »vom Brande im Unterleibe« oder wie auch immer wir heute diese Krankheit bezeichnen würden, in wenigen Wochen hinweggerafft.
»Sein Hinscheiden ... hat uns mit wahrem Schmerze erfüllt, denn wir haben einen arbeitsamen, geschickten, religiösen und frommen Mann verloren, der schwer zu ersetzen ist,« kondolierte Erzbischof Lothar Anselm an das Münchner Domkapitel.
Der verstorbene Domherr wurde auf dem Sendlinger Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Er starb, da er alle seine Einkünfte zur Unterstützung seiner von ihm aufgebauten Schulen verwandte, völlig mittelos. 1831 fand unter dem Domkapitel eine Sammelaktion statt, um für ihren Mitbruder einen schlichten Grabstein aufrichen zu können. Auch Lothar Anselm von Gebsattel gab ein erhebliches Schärflein dazu bei.
Und auch der »Nachrücker« für den verstorbenen Aingler trug sich auf der Spendenliste ein: Georg von Oettl. Seines Zeichen gebürtiger Bauernsohn von Gengham bei Palling (also wieder ein Rupertiwinkler). Seine Laufbahn führte zu einem besseren Ende. 1846 wurde er zum Bischof von Eichstätt ernannt, ihn dessen Dom er auch bestattet liegt.
Johann Baptist Aingler aber muss man mit allem Fug und Recht als einen hochrangigen und bedeutenden Geistlichen einstufen, in einer Phase, da für Kirche und Staat neue getrennte Wege begannen. Ganz abgesehen davon, dass er durch beachtliche Pionierleistungen dem jungen Volksschulwesen beispielhaft die Wege vorzeigte.
Albert Rosenegger
Quellen:
Diözesanarchiv München, Personalakt J.B. Aingler, Metrop.Kap. XIII/3
Zeitschrift des Salzburger Lehrervereins, VIII. Jng., Nr. 3, 1878
Monachium sacrum, Bd I., München, 1994
Krone u. Verfassung, König Max I. Joseph und der neue Staat Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1799-1825 München, 1980
Ludwig Schrott, Bayerische Kirchenfürsten, München, 1964
Helga Reindl-Schedl, Häuserbuch Markt Teisendorf, 1994, Nr. 111
Gerhard Leonhard, Schulgeschichte von Kirchdorf a. H. in: Der Mangfallgau, Heimatkundliches Jahrbuch für den Landkreis Bad Aibling, 9. Jahrg., 1964
Josef Rosenegger, Geschichte der Pfarrei Haslach, Traunstein 1963, S. 288
Karl Hausberger – Benno Hubensteiner, Bayerische Kirchengeschichte, München, 1985
Jürgen Eminger – Albert Rosenegger, Johann Bapt. Neumüller – ein bedeutender Chiemgauer Maler der Biedermeierzeit, Traunstein, 1994
Herzlicher Dank für freundliche Hilfestellung gebührt Frau Dr. Sylvia Hahn, Diözesanmuseum Freising, sowie Fam. Wallner, Öd bei Teisendorf
8/2006
Dem Maler des Bildes wird man sogleich ein Höchstmaß an Detailgenauigkeit der Konterfeikunst attestieren. Im Signum stellt sich heraus: Das Bild wurde 1825 von dem Vachendorfer Johann Baptist Neumüller angefertigt. Neumüller genoss zuvor ein Privatstipendium des ersten bayerischen Königs Max I. Joseph an der Münchner Kunstakademie und stand ab 1823 weit über dem Chiemgau hinaus, in einem guten Ruf als ausgezeichneter Portraitist und Maler von Sakralbildern. Dass nun der Abgebildete, wie auch der Maler, ihren Weg durch die südostbayerische Region nahmen und sich deshalb ihre Lebenslinien eines Tages kreuzten, stellte sich erst heraus, nachdem sich die Biographie des geistlichen Herrn auf dem Bild aus den noch vorhandenen Schriftquellen langsam herauszuschälen begann.
Dabei trat eine ganz außergewöhnliche Klerikerpersönlichkeit aus dem Dunkel des Vergessenseins. Ein Mann voller Tatkraft und geistiger Frische, ein selbstloser Streiter und Vorkämpfer für ein sozialgerechtes Schulwesen, dessen geistliche Karriere wohl noch weitergegangen wäre, hätte nicht eine unheilvolle Krankheit jäh sein Leben beendet.
Johann Baptist Aingler
Priester und Inspektor der Salzburger Waisenhäuser, Direktor des dortigen Lehrerseminars, Dekan und Lokalschulinspektor von Mittersil, Pfarrer und Schulförderer von Kirchdorf bei Aibling, Pfarrer und Prodekan von Haslach-Traunstein, Dompfarrer von München, Generalvisitator der Erzdiözese München-Freising.
Ein Lebensbild, das sich lohnte, genauer zu verfolgen.
In wahrlich schlichtester bäuerlicher Umgebung erblickte Johann Baptist Aingler am 8.Juni 1780 auf dem Hazn-Gütl in Öd bei Teisendorf das Licht der Welt. Sein Vater nannte sich Thomas Aingler. Er stellte im Nebenerwerb zur Landwirtschaft hölzerne Getreide-Abputzmühlen her, weshalb das Anwesen später den Namen »beim Mühlmacher« erhielt. Seine Mutter hieß Gertraud und war eine geborene Hogger.
Da seine Eltern schon 1758 bei der Hofübernahme verheiratet waren, ist anzunehmen, dass der kleine Johann Baptist ein später »Nachzügler« von mehreren vorgeborenen Geschwistern war, den das kleine Anwesen nur schwerlich hätte ernähren können. Deshalb kam er schon sehr früh von zuhause weg, zu Verwandten in Maria Pfarr im Lungau, die für einen ersten grundlegenden Unterricht des aufgeweckten Buben sorgten.
Seine bestechende Intelligenz öffneten ihm den Weg zu einer philosophischen und theologischen Ausbildung am Salzburger Klerikalseminar. Inmitten der Wirren der Säkularisation empfing Aingler am 4. Juni 1803 in Salzburg die Priestenweihe.
Bereits auf den ersten Sprossen seiner Karriereleiter ließ Aingler erkennen, wie sehr ihm das Schulwesen nahestand. Als Katechet und Inspektor der beiden Salzburger Waisenhäuser wurde der erst sechsundzwanzigjährige Teisendorfer auf Vorschlag des damaligen Direktors des Lehrerseminars Vierthaler, zu dessen Nachfolger bestellt. Als solcher verbesserte er die Ausbildung der Lehramtskandidaten durch weitsichtige organisatorische Maßnahmen. Schon damals begann er, finanzielle Engpässe durch Beiträge aus seinem Einkommen zu überbrücken.
Als ihm 1813 auf Grund seiner in Salzburg erworbenen Verdienste die Pfarrei Mittersil im Pinzgau anvertraut wurde, sah er sich sogleich in erschreckender Weise mit den Niederungen des damaligen Dorfschulwesens konfrontiert. Dort unterrichtete ein alter Lehrer, sein Weib und deren kleine Tochter die Schule. Die Mittersiler Zustände waren so gravierend, dass sie sogar als Negativbeispiel in einer Glosse in den Salzburger Literaturzeitung Beachtung fanden.
Der Schreiber bemerkte: »Die Kinder lasen in elenden Scharteken elendiglich, ohne Ordnung, ohne Zusammenhang, ohne die geringste Spur einiges Nachdenkens. Der Inhalt der Verschriften, die ihnen der Schulmeister vorlegte, waren die 7 Todsünden. Im Sommer blieb die Schule geschlossen, weil keine Kinder kommen, sagte der Schulmeister. Weil der Schulmeister keinen Unterricht erteilet, sagte die Gemeinde.«
Um es kurz zu machen. Aingler, der dem neu organisierten Dekanl- und Pfarramt Mittersil auch als Dekan und Lokalschulinspektor vorstand, machte aus der desolaten Pinzgauer Dorfschule in wenigen Jahren ein vielbeachtetes Aushängeschild.
Schon bei seinem Amtsantritt hielt er eine Predigt über die Vorteile und Notwendikeit einer guten Schulerziehung. Darin forderte er die Jugend zum fleißigen Schulbesuch auf und eröffnete im Herbst des Jahres 1813 die neue Schule von Mittersil.
In Zusammenarbeit mit dem dortigen Landrichter regte er die Gründung einer Verpflegungsanstalt für arme Kinder an, welche eine so große Unterstützung fand, dass die Bedürftigen nicht blos die Mittagskost erhielten, sondern auch für deren Einkleidung gesorgt wurde. Auf einem Bewertungsbogen, über Ainglers seelsorgerische und schulische Tätigkeit im Pinzgau, der im Diözesanarchiv in München verwahrt wird, heißt es: Hat sich als Dekan volle Zufriedenheit erworben, merkbar besseren Geistes als einen rühmlichen Volkslehrer bewiesen, durch unermüdete Anstrengung für Unterricht und Bildung der Jugend, vereinigt mit einer Unterstützung armer Kinder .... sich sohin ein unvergessliches Denkmal gesetzt.«
Als seine Geburtsheimat, der Rupertiwinkl, dem Königreich Bayern angegliedert wurde, bekannte sich der »Wahlsalzburger« auf seine Wurzeln und beantragte nach sechsjähriger, fruchtbarster Tätigkeit im Salzburger Land, eine Versetzung in eine bayerische Pfarrei.
Am 17. Juni 1819 wurde dem Wunsch des Kirchenmannes stattgegeben. Ein Dreivierteljahr später wurde Aingler in die Pfarrei Kirchdorf bei Aibling versetzt. Mit diesem Wechsel wurde er gleichzeitig in die Diözese Freising inkarniert. Auch in Kirchdorf bemühte er sich sofort um die Hebung des Schul- und Erziehungswesens. Unter seiner Ägide wurde ein neues, zweckmäßiges Schulhaus errichtet.
Wie in Mittersil, so ließ Aingler auch in Kirchdorf erhebliche Mittel für schulische Zwecke einfließen, »nicht mit geringem eigenen Kostenaufwande«, wie der Kleinhelfendorfer Distriktschulinspektor Krauß zu bestätigen wusste. Selbst das Landgericht Miesbach, dem die Pfarrei Kirchdorf politisch angehörte, stimmte über Ainglers relativ kurze Amtstätigkeit von gerade einmal zweieihalb Jahren, wahre Lobeshymnen an.
Die hervorragenden Referenzen aus dem Wirkungsstätten des rührigen Schulorganisators drangen bis an die höchsten Stellen des Ordinariats.
Doch ehe man Aingler für höhere Aufgaben vorschlug, stellte man ihn auf eine harte Bewährungsprobe. Er sollte die Pfarrei Haslach-Traunstein übernehmen, und die Zerwürfnisse zwischen Pfarrei und Stadtmagistrat, die sich während der Amtszeit seines Vorgängers Lorenz Zoglauer zu einer unüberbrückbaren Verhandlungskluft um die Pfarrsitzverlegung ausgedehnt hatten, wieder beseitigen helfen. Es mag Aingler ein gewisses Unbehagen nachgegangen sein, als er am 24. Juli 1822 in den schloßähnlichen Pfarrhof von Haslach eingezogen ist. Nun befand er sich ohne eigenes Wollen in einem Gärtopf von Intrigen und Machtkämpfen, von städtischen und ländlichen Positionierungen. Das ausgleichende Wesen Ainglers bewirkte es allerdings, dass in den zwei Jahren, welchem er Stadt und Land als Prodekan vorstand, das Schiff der Großpfarrei wieder in ruhigere Fahrwasser kam. Für solchermaßen wertvolle Dienste an einer so heiß umkämpften Front, verlieh ihm Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel 1823 den Titel des Geistlichen Rates.
Doch nun nahmen die Dinge plötzlich einen ganz anderen Lauf. Als 1824 auf allerhöchste kgl. Anweisung der Münchner Domherr Ignaz Albert Riegg zum Bischof von Augsburg ernannt wurde, galt es die zehnte Kanonikatsstelle des Domkapitels wieder zu besetzen. Auf Befehl seiner Majestät des Königs von Bayern Max. I. Joseph, wurde nun der Haslacher Pfarrer und Prodekan Johann Baptist Aingler in das Kapitelgremium von zehn Geistlichen der Metropolitankirche zu »Unserer Lieben Frau« in München aufgenommen. Das Ernennungsdekret und ein Begleitschreiben, in dem Erzbischof Lothar Anselm seine persönliche »besondere Wertschätzung« für den Ernannten zum Ausdruck brachte, wurden Aingler am 26. Juni 1824 durch einen Kurier im Haslacher Pfarrhof präsentiert. Am 28. Januar 1825 wurde der neue Domherr zusammen mit zwei anderen Chorbrüdern in der Münchner Frauenkirche aufgeschworen.
Im selben Jahr noch, ließ sich Aingler von Neumüller, den er während seiner Amtszeit in Haslach kennen und als Maler schätzen gelernt hatte, im festlichen Chorkleid portraitieren. Es zeigt den 45-jährigen Kanoniker in selbstbewusster würdevoller Haltung. Über dem Hermelin trägt er einen Bandorden.
In der rechten Hand hält er das Birett. Seine Linke ruht in der Schleife seiner Schärpe. Neumüller stellte den hochrangigen Kirchenmann Aingler mit festentschlossenen, aber gütigen Blick dar. Trotz aufgesetzter ernster Mine, lässt sein Gesichtsausdruck verhaltene Züge eines humorvollen Menschen durchscheinen.
Ein Jahr später wurde Aingler das Amt des Generalvisitators der Diözese angetragen. In dieser Eigenschaft bereiste er zusammen mit Gebsattel mehrere Dekanate u.a. auch im Chiemgau.
Dieser Umstand könnte möglicherweise zu einer erneuten Begegnung mit dem Vachendorfer Maler geführt haben, denn im Diözesanarchiv befindet sich ein weiteres Bild Neumüllers, dessen Weg dorthin einige Rätsel aufgibt. Es stellt eine sehr eindrucksvolle Ölbergszene dar, vom Maler eigenhändig signiert und auf das Jahr 1826 datiert. Das dieses Bild der Hinterlassenschaft Ainglers entstammt, erscheint angesichts des Entstehungsdatums als sehr warscheinlich.
Als Generalvisitator führte Aingler ein Wappen, dessen Bezug zum Wappenführer kaum zu verstehen ist.
Ainglers Position im Münchner Domkapitel muss als sehr bedeutend eingeschätzt werden. Dem Gremium der stets zehn Metropolitanchorherren entwuchsen während der Zeit seines Kanonikates sage und schreibe drei Bischöfe.
Wer weiß, wie Ainglers eigene Karriere verlaufen wäre, hätte ihm nur seine Gesundheit mitgespielt.
Bereits am 20.4. des Jahres 1829 wurde er nur neunundvierzigjährig »vom Brande im Unterleibe« oder wie auch immer wir heute diese Krankheit bezeichnen würden, in wenigen Wochen hinweggerafft.
»Sein Hinscheiden ... hat uns mit wahrem Schmerze erfüllt, denn wir haben einen arbeitsamen, geschickten, religiösen und frommen Mann verloren, der schwer zu ersetzen ist,« kondolierte Erzbischof Lothar Anselm an das Münchner Domkapitel.
Der verstorbene Domherr wurde auf dem Sendlinger Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Er starb, da er alle seine Einkünfte zur Unterstützung seiner von ihm aufgebauten Schulen verwandte, völlig mittelos. 1831 fand unter dem Domkapitel eine Sammelaktion statt, um für ihren Mitbruder einen schlichten Grabstein aufrichen zu können. Auch Lothar Anselm von Gebsattel gab ein erhebliches Schärflein dazu bei.
Und auch der »Nachrücker« für den verstorbenen Aingler trug sich auf der Spendenliste ein: Georg von Oettl. Seines Zeichen gebürtiger Bauernsohn von Gengham bei Palling (also wieder ein Rupertiwinkler). Seine Laufbahn führte zu einem besseren Ende. 1846 wurde er zum Bischof von Eichstätt ernannt, ihn dessen Dom er auch bestattet liegt.
Johann Baptist Aingler aber muss man mit allem Fug und Recht als einen hochrangigen und bedeutenden Geistlichen einstufen, in einer Phase, da für Kirche und Staat neue getrennte Wege begannen. Ganz abgesehen davon, dass er durch beachtliche Pionierleistungen dem jungen Volksschulwesen beispielhaft die Wege vorzeigte.
Albert Rosenegger
Quellen:
Diözesanarchiv München, Personalakt J.B. Aingler, Metrop.Kap. XIII/3
Zeitschrift des Salzburger Lehrervereins, VIII. Jng., Nr. 3, 1878
Monachium sacrum, Bd I., München, 1994
Krone u. Verfassung, König Max I. Joseph und der neue Staat Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1799-1825 München, 1980
Ludwig Schrott, Bayerische Kirchenfürsten, München, 1964
Helga Reindl-Schedl, Häuserbuch Markt Teisendorf, 1994, Nr. 111
Gerhard Leonhard, Schulgeschichte von Kirchdorf a. H. in: Der Mangfallgau, Heimatkundliches Jahrbuch für den Landkreis Bad Aibling, 9. Jahrg., 1964
Josef Rosenegger, Geschichte der Pfarrei Haslach, Traunstein 1963, S. 288
Karl Hausberger – Benno Hubensteiner, Bayerische Kirchengeschichte, München, 1985
Jürgen Eminger – Albert Rosenegger, Johann Bapt. Neumüller – ein bedeutender Chiemgauer Maler der Biedermeierzeit, Traunstein, 1994
Herzlicher Dank für freundliche Hilfestellung gebührt Frau Dr. Sylvia Hahn, Diözesanmuseum Freising, sowie Fam. Wallner, Öd bei Teisendorf
8/2006



