Die Saliner waren keine Heiligen
Die »Leichtfertigkeit« des Salinenwegaufsehers Röhrl – Teil III

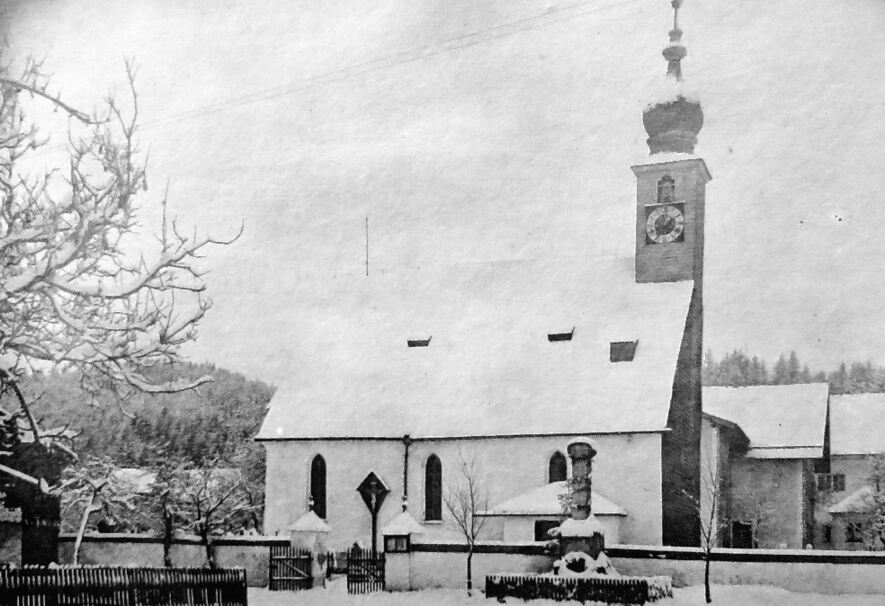

Wer sich der Mühe unterzieht, sich den gewaltigen Berg von Salinenakten im Bayerischen Staatsarchiv München forschungshalber vorzunehmen, der wird bald neben einer Fülle von Abrechnungen und Formalien zum salinaren Geschäftsbetrieb auch auf Schriftstücke stoßen, die ein etwas ungewöhnliches Licht auf die Gemeinschaft der kurfürstlichen Salzbediensteten werfen. Die nachfolgende Geschichte gehört zu diesen Besonderheiten.
Als der Wegübersteher Johann Georg Röhrl zu Pfingsten 1780 an einem freienTag sich anschickte,um in aller Frühe von seiner Wohnung in der kurfürstlichen Au aus nach Teisendorf zu gehen, um dort an einem Scheibenschießen teilzunehmen, konnte er nicht ahnen, welch selbstverschuldetes Ungemach ihn am Ende des Tages erwarten wird.
Von Berufs wegen war er als sogenannter Wegübersteher »auf der Strassen nacher Inzl« für den ordnungsgemäßen Zustand dieses Teilabschnittes der Salzstraße zuständig. Im erweiterten Sinn könnte man ihn auch Straßenmeister oder Wegaufseher in kurfürstlichen Diensten nennen.
Es war der Pfingstmontag des Jahres 1780 als Röhrl das »Schießet zu Deisendorf« besuchte und auf dem Rückweg beim Oberen Wirt in Oberteisendorf zukehrte. Zur selben Zeit betrat die um viele Jahre jüngere Anna Maria Pflanzin die Gaststube und Röhrl bedeutete ihr, sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Zum regen Wortwechsel, den das ungleiche Paar führte, floss reichlich Bier und Branntwein, den Röhrl großzügig ausgab. Im Verlauf ihrer Unterhaltung stellte sich heraus, dass das Mädchen eine Webertochter aus dem salzburgischen Wagrain und auf der Suche nach einem Dienstplatz war. Sie wollte ebenfalls wie Röhrl nach dem Zwischenaufenthalt in der Gastwirtschaft in Oberteisendorf zu Fuß nach Traunstein gehen. Die zufällige Tischgemeinschaft einigte sich bald, den Weg gemeinsam zu gehen. Ungefähr nach der halben Wegstrecke fing es heftig an zu regnen,wobei die beiden Unterstand in einem Brechlbad suchten. Vom reichlichen Alkoholgenuss enthemmt, kam es dann zu der »sündhafften Begegnung mit dem Weibsbild«, wie es protokollarisch dargelegt wurde, wobei aber davon auszugehen sein wird, dass der Straßenmeister der nicht minder aktive Teil des anstößigen Zeitvertreibes war.
Die Geschichte wäre nie und nimmer ruchbar geworden, hätten sich nicht bei der Wagrainer Weberstochter bald die Folgen der intimen Begegnung eingestellt. Als sie nach neun Monaten einMädchen zur Welt brachte, ergab sich zwangsläufig die Frage nach dem Kindsvater.
Immerhin war die Wöchnerin im Stande, sich an den Namen, den Beruf und Wohnort des Kindserzeugers zu erinnern und diesen sowohl bei der Taufe, als auch bei einem späteren Verhör vor dem hochfürstlichen Stadtgericht in Salzburg anzugeben. Dort gab sie auch über den Gesamtverlauf der Begegnung mit Johann Georg Röhrl ein ziemlich detailliertes Geständnis zu Papier. Der Saliner zechte ihr bei besagtem Wirt einen ziemlichen Rausch an, wobei sie sich beide »wehrend ihres unterstehens sich von dem gehabten Rausch hinreissen (hätten) lassen und (sich dadurch) beide sündhaft vergangen (hätten).«
Dies brachte nun den verheirateten, achtfachen Familienvater von der kurfürstlichen Hofmark Au in gehörige Schwierigkeiten. Erst einmal wies er alle Vorwürfe kategorisch von sich. Bei der ersten Vernehmung bestritt er alle Angaben der Pflanzin. Er kenne weder die Frau noch den Ort Wagrain, war auch nicht mit dieser in der Gaststätte, sondern ging alleine nach Traunstein. »Er wisset sich wahrhaft nichts schuldig. Er habe sich seiner Lebtag nicht mit einem Weibsbild versindigt, weder ledig, noch in seinem verheurathen stand, da er bereits 14 Jahr verehelicht. (Selbst) wen er hundertmahl gefragt werde, kann er nichts anderst sagen, als dass er von diesem Weibsbild nicht das mindeste wisse. Es muß ein rechte Flätl (= liederliche Person) sein, die ihme ansagt.«
Röhrl gab auf seine Aussage das Handgelübte ab, womit er auf freien Fuß gesetzt wurde, unter der Bedingung, dass er sich jederzeit gerichtlich zur Verfügung halten solle.
Dies sollte sich dann auch bald ergeben, denn die nachfolgende Befragung der Oberteisendorfer Wirtin ergab ein anderes Bild. Die Wirtin bestätigte im Großen und Ganzen die Aussagen des Mädchens.
Johann Georg Röhrl musste sich nun vor der Salzmaieramts-Obrigkeit einer erneuten Examinierung unterziehen, die am 8.Mai 1785 vom Salzamtskassier Michael Miller geführt wurde. Vor dem hohen Salinenbeamten revidierte Röhrl nach und nach seine erste Aussage. Er gab zu, das Mädchen beim Oberwirt zu Oberteisendorf kennen gelernt und mit ihr gezecht zu haben, auch hätte er sie nach Traunstein begleitet, weil sie den Weg nicht kannte, – mehr nicht.
Die Aussagen Röhrls konnten den gewieften Salinenbeamten nicht zufrieden stellen. Bereits nahe am Ziel seiner Inquisition, spielte er nun einen letzten Trumpf aus, der tatsächlich die Wende hervorbrachte. Miller schlug eine Gegenüberstellung mit der Kindsmutter vor. Daraufhin brach nun der Wegmacher völlig ein und bewilligte die Übernahme der Vaterschaft.
»Weil es sein muß, so will er Kindsvater sein, man solle ihme das Kind schicken, ob(wohl) er schon weis, daß das Kind nicht von ihme seye, er getraut sich hierauf zu schwieren.« Seiner Ansicht nach war die Anna Maria Pflanzin bereits schwanger, als er sie kennen gelernt hatte. Warum er dann das Kind annehmen wolle, wenn er zweifle dessen Erzeuger zu sein, wollte der vernehmende Salzbeamte wissen. Darauf kam eine reichlich kuriose Antwort.
»Wen das Weibsbild immer sagt, er ist der Vatter, so kann er nicht anderst, als das er das Kind annehme, damit der Prozess und die so vielen Unverdriesslichkeiten die er immer habe einmal ein End nehmen. Bittet aber, dass man ihme keine Schandstraf anthun mechte, in dem es ihme Straff genug dass er das Kind annehme, zu welchem er gewiss nicht Vatter ist, damit aber das Kind einen Vatter habe.«
Nur aus dem Vorschlag Röhrls, dass er das Kind in seine Familie aufnehmen wolle, wurde nichts, denn die bayerischen Behörden weigerten sich »das außer Lands geborene Kind herein zu lassen,« so war der von Selbstzweifeln geplagte »Vater« zur grenzüberschreitenden Alimentation verpflichtet.
Die Haftstrafe für »die sündhafte Schwängerung«, dem Ehebruch schlechthin, fiel hingegen ungewöhnlich mild aus. Die Hofkammer verhängte einen dreitägigen Arrest im Amtshaus bei geringer Atzung, was heißen soll, bei Wasser und Brot, für dessen Kosten der Delinquent selbst aufkommen musste. Bei der Strafzumessung berücksichtigte man seine vielen Kinder, die er zu ernähren hatte. Was aber dem Salzamt und auch dem Hofrat am Wichtigsten erschien, war Röhrls Arbeitseinsatz auf den Salzstraßen und -wegen, zumal gerade zu dieser Zeit noch einmal hoher Schnee ankam. Die Passierbarkeit der Wegstrecken für die Salz- und Holzfuhrwerke musste sichergestellt sein. Da hatte alles andere zurückzustehen.
Albert Rosenegger
Quelle: Staatsarchiv München, Saline Traunstein, fasz.4 / 16 - 21
Teil I in den Chiemgau-Blättern Nr. 5 vom 3. Februar 2024, Teil II in den Chiemgau-Blättern Nr. 6 vom 10. Febraur 2024
7/2024



